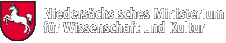War Lessing in Hamburg glücklicher?
- 1965 -
Über Wolfenbüttel und seine Literaten
UM DAS »ENTLEGENE« WOLFENBÜTTEL LESSINGS
In seiner polemischen Schrift »Um einen Goethe von innen bittend« spekuliert der bekannte spanische Philosoph Ortega y Gasset über die Möglichkeiten, was aus Goethe hätte werden können, wenn er nicht mit fünfundzwanzig Jahren »unter die sterile Glasglocke« von Weimar gesetzt und durch Zauberkünste zum »Geheimbderat« präpariert worden wäre. Eine ähnlich geistreichelnde Betrachtung ließe sich über Lessing und Wolfenbüttel anstellen, denn beide Orte, an der Ilm und an der Oker, weisen verwandte Züge auf. Zwar war sechzehn Jahre vor Lessings Übersiedlung nach Wolfenbüttel der Hof aufgelöst worden (1754); aber die nach Braunschweig versetzten Hofbeamten konnten ihre stattlichen, an breiten Plätzen und Straßen gelegenen Häuser nicht mitnehmen. Die Zahl der Einwohner, etwa sechstausend Seelen, war ungefähr die gleiche wie in Weimar. Von den Gebäuden Weimars, dem Mittelding zwischen Dorf und Hofstadt, war, abgesehen vom Markt, nicht viel Rühmens zu machen : jene waren meist alt und häßlich, selten zwei Stock hoch, die Straßen eng, winklig und nur zum Teil gepflastert, wahrlich kein Wunder, daß Goethe sich durch viele Reisen zeitweilig von dem »humusarmen Topf eines Liliputhofes« (Ortega) losriß.
Manche Parallele ließe sich zu Lessing ziehen. Indes ist es wohl eine Legende, wenn immer wieder behauptet wird, er sei mehr oder weniger an Wolfenbüttel zugrunde gegangen. Man mag zugeben, daß seine nach geistigen Auseinandersetzungen verlangende Natur sich an einem größeren Platze eher in ihrem Element fühlte. Aber war Lessing darum in Hamburg glücklicher? In Deutschland gab es nur ganz wenige wirkliche Metropolen. Dazu gehörten weder Hamburg noch Wolfenbüttel, und das wußte Lessing gewiß, als er dorthin zog, denn er suchte die Stille der kleinen Stadt. Im übrigen war er anfänglich mit den Obliegenheiten des Bibliothekars ebenso wie mit seiner Besoldung zufrieden.
In seinen Studien zur Geschichte und Theorie des Mißverstehens auf den kulturellen Gebieten, zusammengefaßt unter dem Titel »Der verkannte Künstler«, spricht Franz Roh in dem sonst ausgezeichneten Kapitel über Lessing von dem »entlegenen« Wolfenbüttel. Weiß er nicht, daß Lessing nur etwas über eine Stunde zu gehen brauchte, um sich mit seinen gelehrten und musischen Freunden vom Braunschweiger Carolinum (der heutigen Technischen Hochschule) im Großen Weghause zu treffen? Lessings gelegentliche Klagen über den »gänzlichen Mangel allen Umgangs« dürfen nicht zu wörtlich genommen werden! Welchem Genie wären solche Anfälle von Hypochondrie erspart geblieben? Über diese Neigung zu schwarzseherischem Unmut sagt Erich Schmidt in seiner klassischen Biographie : »Äußerungen in so herbem, wegwerfenden Ton sind bei Lessing nie für bare Münze zu nehmen«. Was die Klagen betrifft, so vergleiche man Goethes Murren über das von höfischem Dünkel erfüllte, klatschsüchtige Weimar.
Ortega y Gasset versteigt sich zu der These, Weimar habe Goethe von der Welt und von sich selbst getrennt. Der Österreicher Josef Nadler erklärt in seiner umfangreichen »Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften«, gegen Ende seines Lebens sei Lessing das Malheur passiert, als »Büchereiwart« in einen falschen Stammesraum geraten zu sein! Wenigstens ein Prachtstück von Nadlers Stilistik, reich mit militaristischen Bildern ausstaffiert, möge folgen : »So in Wolfenbüttel unter Büchern zu sterben, nach einem fröhlichen Reiterleben, das viele Siege, doch keine Beute brachte, war das keine Tragödie, wenn der Tote Lessing hieß?«
Daß die Vorsehung den gebürtigen Schlesier nach Niedersachsen verschlagen hatte, was Nadler so tragisch nimmt, änderte nichts an Lessings Bestimmung. Von seiner aufrechten Männlichkeit dürfte hinfort keine Rede mehr sein, hätte er in dem vom Hofe verlassenen Städtchen an der Oker kapituliert. Und ist es wirklich so wichtig, wo ein großer Geist lebt? Wird nicht seine Größe den Ort erhöhen, den er sich zum Wohnsitz nimmt?
Anmerkungen
Vergl. dazu auch unser Stichwort - GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
**************************
KURT MEYER-ROTERMUND ÜBER SICH SELBST
Meine Vaterstadt Wolfenbüttel, in der ich am 16. 3. 1884 als Sohn eines Arztes, der Bauernblut in seinen Adern hatte, zur Welt kam, war mit ihren mannigfaltigen Überlieferungen und ihrem Stadtbild wohl geschaffen, historische und literarische Neigungen zu erzeugen. »In der Kindheit wird dem heranwachsenden jungen Menschen das ganze Gut seiner Kultur, in der er aufwächst, vermittelt, nicht nur der reine Wissensstoff, sondern vor allen Dingen auch die Anschauungen, die Gewohnheiten, die in seiner Kultur Geltung haben.« (Arthur Jores). Das Fundament der Werte aber helfen auch die Menschen bauen, mit denen die Jugend in Berührung kommt. Und hier ist in erster Linie zu nennen mein Gymnasialdirektor Wilhelm Brandes (1854 - 1928), eine dynamische Persönlichkeit, in der Humanist, Balladendichter und Raabe-Enthusiast sich auf das Schönste vereinigten. Es konnte nicht ausbleiben, daß ich mich schon als Schüler zu dem großen Braunschweiger Erzähler bekannte, der mir sogar im engsten Kreise, bei einer Geburtstagsfeier seiner einzigen Schwester, persönlich begegnete. So sehr ich für diese ein wenig altfränkische Welt aufgeschlossen war, die mir auch in dem nach Lavendel duftenden Bereich einer unvergessenen »Klostertante« nahetrat, so sehr ich mich vom Biedermeiertum der »Chronik der Sperlingsgasse« und der »Alten Nester« angezogen fühlte, völlig konnte ich mich diesem romantischen Bezirk nicht überliefern, zumal ich zu spüren begann, daß ein neues, stark verändertes Deutschland längst »angekurbelt« war. Auch hatte meine etwas eigenbrötlerische Natur von je her die Scheu, sich irgendwie festzulegen, sei es geistig, sei es gesellschaftlich. Als ich im Jahre 1905 in Göttingen Student wurde, trat ich zwar einer farbentragenden Verbindung bei, focht ein Dutzend Mensuren, blieb aber dem »Couleurbetrieb« gegenüber stets kritisch gesinnt. Ebenso ist es mir nicht gegeben, das Programm einer politischen Partei restlos zu unterschreiben. Wer Erasmus von Rotterdam, Montaigne oder Jakob Burckhardt verehrt, der wird es verstehen, daß ich alles mied, was mich eingleisig und herkömmlich bedünkte. Während die Mehrzahl meiner Kommilitonen in München die großen Bräus frequentierte und im Rahmen des üblichen Verbindungslebens blieb, saß ich nächtelang im »Simplizissimus« bei der Kathi Kobus und suchte Tuchfühlung mit der Boheme. Meine Gedichte aus jener unbürgerlichen Zeit waren abgestimmt auf den sentimental-spöttischen Ton eines Frank Wedekind; er änderte sich, als ich nach dem Studium Johannes Schlaf, den Mitbegründer des deutschen Naturalismus und Anreger Gerhart Hauptmanns, persönlich kennenlernte. Trotz des Altersunterschiedes führte dies zu einer Lebensfreundschaft. Meine 1906 erschienene Monographie über Schlaf hatte diese menschlich wertvolle und geistig fruchtbare Beziehung eingeleitet; gegenseitige Besuche in Weimar und Wolfenbüttel waren gefolgt. - Im Jahre 1907 veröffentlichte ich eine Studie über den damals noch nicht weltbekannten Norweger Knut Hamsun, die ich während meines Studiums in Marburg verfaßte. Es war die erste deutsche Würdigung in Buchform.
Als ich nach Schriftleiter-Jahren im Bergischen Industriegebiet und in Ostfriesland wieder in der Vaterstadt ansässig wurde, machte ich mir neben meiner Berufstätigkeit die weltberühmte Bibliothek zunutze : die Frucht waren die in Gemeinschaft mit dem Osnabrücker Lyriker und Literaturkenner Ludwig Bäte herausgegebenen Anthologien, die sich mit der deutschen Kleinstadt, dem deutschen Pfarrhaus sowie dem deutschen Nachtwächter beschäftigten. In dem Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel fand ich genügend Quellen für meinen historischen Roman »Der Ritter der Winterkönigin« (1938), in dem ich für den zu Unrecht geschmähten »Tollen Christian« eine Lanze brach. Die Stadt Wolfenbüttel, in der mehr als ein Dutzend Kapitel spielen, dankte mir durch eine Dotation. Anläßlich meines 75. Geburtstags (16. 3. 1959) erfreute sie mich durch Verleihung des Ehrenbürger-Titels. Diese Auszeichnung war durch ein halbes Dutzend Buchveröffentlichungen veranlaßt, die ich meiner Vaterstadt gewidmet habe.
Angesichts dieses literaturgeschichtlichen und heimatgebundenen Wirkens mag die Frage auftauchen, ob denn das dichterische Feuer ganz niedrig gebrannt habe. Darüber müssen andere urteilen. Ich kann nur berichten. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlichte ich einen realistischen Roman »Fische im Netz«, der in einem Kleinleute-Milieu Berlins spielt. Hinzu kamen dramatische Versuche, u.a. das Schauspiel »Der Rausch der Jugend«, ein unromantisches Gegenstück zu »Altheidelberg«. Es wurde mehrmals aufgeführt, ebenso wie verschiedene Einakter. Zwischendurch gab es lyrische Bändchen. Aber die Zeitläufte stellten an den Schriftleiter ihre Ansprüche, bis mir 1938 die derzeitigen Machthaber diese Bürde abnahmen. Fünf Jahre darauf verzog ich ins Lippische und wohnte zuerst in einem reizenden Dorf. Seit 1950 bin ich in Bad Salzuflen ansässig in einem Häuschen nahe dem Kurpark. Der beruhigenden Umwelt entsprossen noch zwei Bändchen Gedichte.
Mit Distanz die sich täglich verändernde Welt betrachtend bin ich des Virgil-Wortes eingedenk, daß es mit zum Schönsten gehöre, wenigstens im Alter:
RERUM COGNOSCERE CAUSAS.
Quelle
Kurt Meyer-Rotermund, Wolfenbüttel und seine Literaten. Wolfenbüttel : Ernst Fischer, 1965, S. 22 - 25; S. 69 - 72.
Publikationen
| Titel | Rubrik | Verlag, Verlagsort | Erscheinungsjahr | Erwähnte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Wolfenbüttel und seine Literaten | Ernst Fischer Wolfenbüttel | #1965 | ###morelink### |