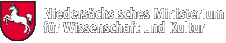Matthis brekket dat Is
- 1870 -
Aus: »Hundert Jahre. 1770 - 1870«
Am Dienstag morgens hatten sich auf dem Amthofe zu Heustedt eine große Menge Bauern eingefunden aus zehn bis zwanzig Dörfern, meist Bauermeister, Eidgeschworene und Deichgeschworene. Es existirte ein geregelter Deichverband nicht. Die Deichlast war nach einem unbestimmten Herkommen zwischen Domänen, adelichen Gütern, Stiften, Gemeinden und einzelnen Grundbesitzern höchst ungleich vertheilt. In der Regel trugen die Anlieger die Deichlast, hier und da aber auch weit hinterliegende, dem Überschwemmungsterrain überhaupt ausgesetzte Ortschaften.
So waren Deichcommissionen entstanden, in denen die Ritterschaften, die betheiligten Städte und Flecken neben fürstlichen Beamten und von diesen angestellten Technikern vertreten waren. Eine solche Deichcommission, welcher der Oberhauptmann von Schlump präsidirte, war heute versammelt, die Betheiligten geladen.
Als in der großen Amtsstube die nöthige Ruhe eingetreten war, was ziemlich langsam von statten ging, erhob sich der Oberdeichgräfe und sprach:
»Hört mal, Künners, in 'ne Tiet von acht Dagen hewt wie grot Water. Ji wättet, Matthias brickt dat Is, un so is et ook - up en paar Dage fröher oder later kumt et jo ook nich an. De Isgang schall wol scharp weren, un hewt wie Westwind, so driwt dat Is ünnen gegen de Dieke, un weiet de Wind von Noren her, so geit et baben los, un da sind de Dieke, wat ji ook wätet, verdammt slegt. In'n Sanddiek da sitt een Muse= un Winnewörpslock bi den annern. De schöll jo ook all vör dree Jahren upsmäten un breer macket weren; un den Spraker=Diek, den geit et nix bäter. Ick hewwe et ju genaug seggt, un nu kriegt ji Jone Last un Strafe. Wie mät de Arbeit aber verdehlen, un up den verschienen Stähen mot ene dat Kummandiren dohn. Kumm du mal her, Hans Dummeier, du schallst dat Seggen baben de Wesserbrügge hebben. Ick will di denn wol wisen, wat du dohn schallst. De Dickvaget kummandirt van de Brüggen bett na Hingstenbargen, un von da av ick sülbenst. De Buren von den böbern Diek führt morgen fiefdusend Bund Busk un twintig Schock Stroh up den Sanddiek, un de adelichen Häwe, de Kerke un de ut der Stadt un de Buren von Hengstenbarge dreidusend Bund Busk und drüttig Schock Stroh up den Schaardiek achter de Diekmählen. Up jede von düssen Stähen mät bett Dönnerstag hunnert Sandsäcke wäsen. Hewwet ji mi nun verstahn?«
Nun erhielt Hans Dummeier Specialinstruction. Herr Oberhauptmann von Schlump hielt darauf eine Anrede und ermahnte, den Befehlen des Oberdeichgräfen streng zu gehorsamen. Der Baron von Vogelsang fühlte als Landrath die innere Verpflichtung, auch ein Wort zu sagen, er erhob sich, machte den Ansatz, aber die Bauern drängten zur Thür hinaus, und er konnte nicht mehr zu Worte kommen.
Es regnete fein, was man in Heustedt stöbbern nannte. Als am folgenden Tage Wagen um Wagen den Deichen zufuhr, um Faschinen, Stroh und sonstige Zubehö-
rungen auf die Deiche zu bringen, regnete es schon stark, und so regnete es zwei Tage und drei Nächte. Der weiße Schnee war in dieser kurzen Zeit von allen Feldern, selbst von den nach Norden gekehrten Wänden der Gräben verschwunden. Das Wasser stand zum Theil über dem Eise der Weser. Erst nach einigen Tagen sah man am Pegel, daß der Wasserstand um einige Fuß gestiegen war. Das Eis hatte sich von den Ufern abgetrennt. Es kam Matthias, aber er brach das Eis nicht. Am vierten Regentage krachte das Eis zum ersten Male, donnerähnlich. Tiefe Spalten und Ritzen bildeten sich. Die Eisschollen vor den Eisbrechern wurden langsam höher und höher an diesen hinaufgeschoben.
Das Wasser war bis Sonntag auf zwölf Fuß gestiegen, und zur Verwunderung vieler ging das Eis unterhalb der Brücken am Sonntage gegen Abend ohne viele Schwierigkeiten fort.
Allein die unvorsichtigen Bewohner der Oststadt wurden des Nachts durch Alarmschüsse und Geschrei erweckt, und mancher, der aus seinem Bette sprang, trat bis an die Knöchel ins Wasser. Aus den Ritzen der Fußböden in der Hinternstraße quoll das Wasser bald fußhoch in die Stuben und Kammern, und in den Straßen begann sich an den tiefern Stellen das Wasser zu zeigen.
Nun erhob sich eine ungemeine Geschäftigkeit. Vor dem neuen Schlosse und an dem Thorwege zum Park wurden die großen Pechpfannen angezündet, die mit ihrem rothen und qualmigen Lichte das Schloß und einen Theil der Schloßstraße erleuchteten. In dieser begann ein buntes Getreibe bei Fackel= und Laternen=Erleuchtung. Nachdem die Einwohner nämlich vor allem die Keller geleert und alles Werthvolle aus den Räumen zur ebenen Erde auf die Böden und in die oberen Wohnungsräume gebracht hatten, fing man an, die Häuser einzudeichen, damit sie von der Straße her nicht durchflutet würden. Man schlug etwa drei Fuß voneinander Pfähle in das Pflaster des Trottoirs, lehnte Dielen dagegen und füllte die Zwischenräume mit Strohdünger aus, drei bis vier Fuß hoch, je nachdem die Straße niedriger oder höher lag. Ein solcher Düngerdeich wurde unmittelbar vor den Häusern hergezogen. Auf der andern Seite der Straße, wo die Häuser nicht dicht aneinanderstanden, mußte jedes einzelne Haus umdeicht werden. Das Wasser in den Straßen stieg zusehends. Schon kamen aus der ganz unter Wasser gesetzten und verlassenen Weserstraße Kähne mit Betten, Möbeln und Hausgeräth, Wiegen, schreienden Kindern aus den ärmlichen Wohnungen der Hinternstraße geflüchtet, wo obere Wohnräume nicht existirten, vor dem Schloßthore an. In der Schloßstrasse selbst stand das Wasser nun noch nicht so hoch, daß man die Kähne benutzen konnte, deshalb mußte dann in dieser Hausgeräth, Kinder, Betten u.s.w. die ganze Schloßstraße hinauf bis kurz vor dem Rathskeller, wo es wasserfrei war, von Männern in Wasserstiefeln getragen werden. Auch Frauen und Mädchen wurden so getragen. Vor dem Vogelsang'schen Burghofe, vor dem alten Schlosse und vor dem Rathskeller brannten gleichfalls Pechflammen. Es war ein unheimlich romantischer Anblick, wenn man vor dem Rathskeller stand und die Schloßstraße hinansah.
Dazu erschallten von Norden her von Zeit zu Zeit starke Donnerschläge. Das Eis hatte sich bei Paß Hengstenberg gestopft und der junge Herold versuchte Sprengungen mit Pulver.
Als der Morgen herbeikam, sah man den größten Theil des Alvensleben'schen Parks, die ganze Schloßstraße, Weser= und Hinternstraße, die Kirche und den Kirchplatz, die Wohnung des Superintendenten, des Forstmeisters und des Barons von Bardenfleth im Wasser stehen. Frei von Wasser war in der ganzen Oststadt nur die Amtsstraße, der Rathskeller mit seinen beiden Nachbarhäusern und gegenüber das Castrum des Landraths von Vogelsang, das alte Schloß und der Raum zur Weserbrücke.
Die Weststadt war ganz wasserfrei, allein das Wasser war durch den Rückstau, der es von Hengstenberg nach Grünfelde trieb, auf achtzehn Fuß gewachsen, und die ganze Halbinsel jenseit der Graft bis an das Geestterrain stand eine Stunde weit unter Wasser, denn hier war die Weser nicht eingedeicht.
Der Überfall fing zu laufen an und bald stand das herrschaftliche Boswiehe zwischen den Deichen und der Langenstraße mehrere Fuß unter Wasser, welches bei höherm Wasserstande durch die Lütjestraße in die Deich= und Langestraße eingedrungen wäre, hätte man diese nicht durch ständige Vorrichtungen abgesperrt.
Die Bewohner der linken Seite der Langenstraße waren aber schon seit der Nacht beschäftigt, die Deiche, welche ihre Gärten von den Abzugsgräben trennten, zu erhöhen. Man fuhr Stroh, Dünger und Faschinen herbei und befestigte die neu herbeigeschafften Materialien durch Pfähle auf dem oder neben dem alten Deiche. So kam der Morgen.
Alle gewöhnlichen Geschäfte hatten aufgehört, alle Schulen waren ausgesetzt, gerichtliche Termine wurden nicht abgehalten, es war Justitium eingetreten. Männer und viele Frauen, wie die meisten Knaben, gingen in hohen über die Knie reichenden Wasserstiefeln. Die Kinder würden sich massenweise herumgetrieben haben, wäre das Wetter nicht gar so schlecht gewesen, und hätten sie bei dem Eindeichen nicht hülfreiche Hand leisten müssen.
Gegen Mittag hörten Regen und Sturm plötzlich auf, die Luft wurde auffallend rein und warm, der Wind hatte sich ganz nach Süden gedreht. Nun begann in der Schloßstraße und deren Umgebung ein eigenthümliches Getreibe, man glaubte sich plötzlich nach Venedig versetzt. Zehn und mehrere große Kähne fuhren in der Straße auf und ab, um die Bewohner auf festes Land zu bringen. Hier war es so voll wie an einem Jahrmarktstage. Die Männer, welche aus Erfahrung wußten, daß an solchen Tagen auch das Kochen aufzuhören pflegte, weil die Metzger kein Fleisch bringen und schaffen konnten, hatten sich schon zum Frühstück auf dem Rathskeller eingefunden. Wir reden von den sogenannten Honoratioren.
Wirth Krummeier kannte den »Dreh«, wie er sagte, aus vierzigjähriger Erfahrung. Er hatte alles, was der Herr Landrath, der Oberhauptmann, Herr von Bardenfleth, der Forstschreiber und sonstige Gutschmecker irgend bei ihm verlangen konnten, in Hülle und Fülle herbeigeschafft. Schöne Gänsebrüste, feine Mett= und Leberwurst, marinirter Aal und Schlie, Rauchfleisch und Schinken, Käse der verschiedensten Sorten nebst Butter und Brot stand auf einer Tafel bereit, und ein jeder nahm sich nach Belieben. Alle diese Speisen wurden altherkömmlich beim Eisgange gratis verabreicht, nur die Getränke wurden bezahlt. Aber auch diese Getränke waren herkömmlich vorgeschrieben, es konnte der einzelne, der in dieses Umsonstzimmer trat, davon nicht abweichen. Alle tranken sogenannten steifen Grog. Der Forstschreiber behauptete zwar, er sei nicht steifer als der, den man allabendlich tränke, obgleich er das Anderthalbfache theuerer war, allein man trank, trank sehr viel, natürlich der schlechten Witterung wegen.
Es war ein ordentliches Fest hier. Oben im Tanzsalon, der seine Front dem alten Schlosse und der Brücke zuwandte, hatten sich mittags die Damen versammelt, um den Eisgang zu erwarten und Kaffee zu trinken. Unten gingen die meisten Anwesenden vor Ungeduld aus und ein. Mehr als einmal hatte schon ein Spaßvogel in das Zimmer gerufen: »Das Eis geht!« und alles war hinausgestürzt. Nur der Forstschreiber war auf seinem Platz geblieben und hatte erklärt, keine vier Pferde zögen ihn von demselben, bis er selbst sehe, daß sich das Eis bewege.
Es mochte ein Uhr nachmittags sein, als der Forstschreiber selbst die Bemerkung machte, das Eis bewege sich, und im Nu war das Zimmer leer. Der Forstschreiber hatte recht gesehen, das Eis war in Bewegung gekommen, stand aber schon wieder. Soweit man vom Rathskeller, soweit man von der Brücke sehen konnte, war alles bisher nur eine Fläche glatten Eises gewesen, jetzt sah es aus, als wenn mit einem Riesenpfluge Furchen über diese Fläche gezogen seien, und zwar Furchen von fünf bis zehn Fuß Höhe und Tiefe. Das Eis stand jetzt senkrecht. Nur an den Eisbrechern hatte es sich bis an die Spitzen hinaufgeschoben, und mächtige zwei Fuß dicke Schollen hingen an der Spitze, ohne zu zerbrechen.
In diesem Augenblick kamen Heinrich und Friedrich Schulz mit ihrem Backtroge auf dem Kopfe über die Brücke. »Dürfen wir mit Karl schiffen, in der Schloßstraße nur?« redeten sie den Forstschreiber an. Dieser ließ sie den Backtrog absetzen, untersuchte diesen von außen und innen, winkte ein paar Zimmerknechten, die er den Trog zu Wasser tragen hieß, schenkte den Jungen ein Viermariengroschenstück und hieß sie seiner Frau bestellen, sie sollte Karl schicken und selbst baldmöglichst zum Rathskeller kommen.
Wer war glücklicher in diesem Augenblick als die beiden Knaben? Der Trog bewährte sich als seetüchtig, Heinrich führte die Stange, Friedrich das Ruder, man schiffte in die Heustraße ein und landete vor Forstschreibers Hause. Karl sprang die Treppe hinab und wäre ins Wasser gefallen, wenn ihn Heinrich nicht aufgefangen hätte. Das war aber eine Lust; man schiffte um die Kirche und schiffte die Schloßstraße auf und ab. Friedrich war ein aufmerksamer Steuermann. Als er zum zweiten Mal die Ecke berührte, wo Bardenfleth's Hof aufhörte, sagte er: »Bruder, das Wasser fällt, fällt bedeutend. Ich weiß gewiß, daß, als wir vor zehn Minuten an dieser Stelle waren, das Wasser wenigstens vier Fuß tief war, jetzt hält es keine zwei.«
»Dann hat die Weser unten Luft gekriegt, und dann muß auch das Eis losgehen«, sagte Heinrich.
»Laß uns eilen, die Straße hinaufzukommen«, äußerte der Sohn des Forstschreibers, »ich habe noch nie einen Eisgang gesehen.«
Das geschah. Aber die Knaben warteten nicht ab, bis sie nicht mehr mit ihrem Fahrzeug weiter konnten, sondern sobald sie nur festen Fuß mit ihren Wasserstiefeln zu haben glaubten, verließen sie dasselbe, zogen es bis aufs Trockene und eilten zur Brücke.
Dorthin eilten auch alle, welche von dem Phänomen des plötzlich fallenden Wassers in den Straßen gehört hatten, aber das Eis oberhalb der Brücke regte sich nicht; der Pegel zeigte denselben Wasserstand wie vorhin. Die Ursache des Fallens sollte auch jedermann bald klar werden. Von Norden her erschallten sechs Kanonenschüsse, ein Zeichen, daß der Deich nicht mehr zu halten oder schon gebrochen sei. Das Zeichen kam zu spät, was seinen Grund darin hatte, daß der mit dem Zünden der Kanonenschläge betraute junge Herold von diesen selbst durch den Deichbruch getrennt wurde. Die Deichmannschaft, welche jene Nothsignale bei sich führte, kam jenseit des Deichbruches zu stehen, und Herold mußte erst von Hengstenberg neue Kanonenschläge holen lassen.
Indessen war aus einem zwölf Fuß langen Durchbruche von zwei bis drei Fuß Tiefe ein Loch von fünfzig Fuß entstanden und der Deich bis auf die Sohle weggerissen. Das Wasser in der Oststadt verlief sich noch schneller, als es gekommen war, der Rückstau hatte aufgehört, das Eis auch bei Hengstenberg Luft bekommen.
Währenddessen war man oberhalb der Brücke und des Überfalls bei dem Deiche des Sandmeiers auch nicht müßig; das Wasser spülte bis an den Kopf des Deiches und auf der Binnendeichseite war eine andere Communication als zu Wasser nicht mehr möglich, da das Boswiehe durch den Überfall schon bis fünf Fuß unter Wasser gesetzt war. Darauf vorbereitet, hatte man an verschiedenen Ort Deicherde aufgehäuft, und noch immer wurde solche vom Sande her, wo der Deich mit der Geest in Verbindung stand, herbeigefahren.
Es war ein reges Treiben hier. Dummeier war bald auf diesem, bald auf jenem Fleck, denn man arbeitete an drei bis vier Stellen, denen die meiste Gefahr drohte. Er sah aber ebenso häufig nach dem Himmel als nach der Weser. Jener wollte ihm nicht mehr recht gefallen. Es hatten sich am nordöstlichen Himmel dunkle Wolken, Gewitterwolken ähnlich, gebildet, welche trotz des Südwindes rasch emporstiegen. Da hörte man die sechs Kanonenschläge. »Dat is de Moordorper Diek«, sagte Hans, »de da to'n Düwel geit. Nu schull ji mal sehn, Jungens, wie dat Is nu Luft kriegt un losgeit.« Und wie gesagt, so geschah es. Erst langsam, kaum merklich, schoben sich die Massen zusammen, noch einmal krachte es, als würde die Erde in ihren Grundfesten erschüttert, dann sah man, wie die auf den Eisbrechern ruhenden Schollen über die Spitzen derselben hinweggeschoben wurden. Auf den Spitzen brachen aber die Schollen auseinander, küselten unter das Wasser und eilten unter der Brücke hinweg. Eine Eisscholle suchte der andern zuvorzukommen, es war ein Drängen, Reißen, Stoßen, Übereinanderhinwegstürzen.
Vom Wasser sah man nur hin wieder eine kleine offene Fläche, um welche sich sofort eine Masse Eisschollen zu streiten schienen. Trotz des Eisganges stieg das Wasser und schien sich gelblich zu färben. »Is all Fuldewater«, brummte Hans.
Gesprochen wurde auf dem Deiche wenig, denn das Geräusch war so groß, daß man ein menschliches Wort nicht verstand, man verständigte sich durch Zeichen.
Dummeier's Aufmerksamkeit wurde plötzlich durch eine Erscheinung in Anspruch genommen, die ihn mit Besorgnis erfüllte. Es kamen ein paar Riesenschollen mit zahlreichem Gefolge auf den Überfall zu. Der Wind war umgesprungen und wehte stark von Nordost und trieb Eis und Wasser jetzt gegen die Deiche.
Wenn solche mächtige Eisschollen, wie sie jetzt dem Überfall sich nahten, darüber hinweggingen, so war die doppelte Gefahr vorhanden, einmal, daß diese Schollen die Grasnarbe des Überfalls zerstörten, wol gar einen Deichbruch verursachten, und sodann, daß sie gegen die kleinen schwachen Deiche vor den Gärten der Langenstraße getrieben wurden und diese zerstörten. Hans versuchte hier mit funfzig Mann was möglich war, um die Eisschollen abzuhalten, aber alle Anstrengungen waren vergebens. Der immer stärker wehende Wind trieb die Eisschollen jetzt mehr gegen die Deichseite, sie schoben sich am Deiche bis auf den Kopf hinauf und passirten den Überfall in seiner ganzen Breite.
Während dieser Anordnung waren die schwarzen Wolken hoch an den Horizont hinaufgezogen und es brach eins jener Wintergewitter los, die so überaus gefährlich sind. Der Wind hatte sich ganz nach Nordosten gedreht, und während bisher eine Menge der Schollen auf dem gegenüberliegenden unbedeichten Ufer gelandet waren, wurden sie jetzt gegen den Deich getrieben, sobald sie der Mächtigkeit des Stromes selbst entzogen waren. Donner vom Himmel, Schloßen, welche der Sturm den Deicharbeitern in das Gesicht trieb und sie beinahe unfähig machte, etwas zu sehen, dazu das Grollen, Stoßen, Drängen, Platzen und Aneinanderschmettern der Eisschollen und zunehmende Dunkelheit. Dann ein greller Blitz und unmittelbar darauf ein mächtig krachender Donnerschlag. Die gesammte Deichmannschaft stand starr und stumm. Jedermann fühlte, daß es eingeschlagen haben mußte. Es sollte auch nicht lange in Ungewißheit bleiben, daß und wo dies geschehen. Drüben im Westen, aus dem Eichwalde, welcher Eckernhausen versteckte, flammte ein Strohdach bald lichterloh zum Himmel. Alle Blicke wandten sich dahin.
»O gutte Gutt! Donnerwähr! Diekschworner, et brennt in Eckernhusen, nu kiek mal, is dat nich Jue Hus? Man kiekt jo in de Flamme up den Karkenthoren. Man to, wie mätet los, loopt to!« so erscholl es von vielen Stimmen durcheinander. Hans selbst zweifelte keinen Augenblick, daß sein Haus brenne, er glaubte die Pferdeköpfe des nach Süden gerichteten Giebels mit dem Storchenneste dahinter deutlich zu erkennen. Inzwischen hatten sich einige vierzig Männer aus Eckernhausen um ihn versammelt und drängten ihn, das Commando an den Deichgeschworenen eines andern Dorfes abzugeben und mit ihnen nach Haus zu eilen.
Hans sagte mit Entschiedenheit: »Ik bliebe hier un jie ook, blot juer ses könnt na Hus hen gahn. Ernst und Johann Meyer, Dierk Niebour, Stoffel Piepenbrink, Jobst Petermann und Cord Cordes. Alle Annern bliebet an Platze, denn hier brennt et ook, un wenn wi hier nich uppasset, so versüppet dat ganze Dörp un use Koren geit to'n Dübel, un dat von annere Dörper ook, un dat is doch leger as wenn mal en Hus afbrennt. Wie hewwet ja Nordostwind, un dat Füür drift um minen Eicksünner un nich up dat Dörp. Hinner den Holt ligt aber de Karken, de is massiv un hät Pannendäcker, da hört aber all wat to.«
Man überzeugte sich um so schneller, daß Hans recht habe, als unter den Füßen der Versammelten, etwa sechs Fuß unter der Kappe des Deiches, ein armdicker Wasserstrahl emporschoß. Von außen hatten Eisschollen an den Deich gestoßen, die Grasnarbe abgeschält, gerade an der Stelle, wo sich viele Mauselöcher im Deiche befanden. Das Wasser war durchgesickert und hatte sich in kurzer Zeit einen Weg gebahnt.
»Schlagtmeister«, rief Hans mit Donnerstimme, »dei groten Laakens, dei groten Laakens.«
Große Laken von starker Segelleinwand, an deren einem Ende dicke Backsteine eingenäht waren, wurden herbeigebracht und an der Außenseite des Deiches langsam heruntergelassen, drei übereinander, dann befahl Hans, in den Deich bis zur letzten Stelle hineinzugraben und diese mit Faschinen und Sandsäcken zu dichten. Dies alles mußte geschehen, während der Sturm starke Hagelkörner im heftigsten Niederschlag den Arbeitern in das Gesicht wehte. Die Eisschollen hatten sich indeß den Überfall hinabgestürzt, es war die mächtigste dabei glücklicherweise zerschellt.
Als das Gewitter vorübergetobt, drehte sich der Wind nach Süden, was zwar für die Deiche Schutz gewährte, dagegen bei dem Feuer gefährlich werden konnte, da es dasselbe auf die Scheunen und Stallungen zutrieb. Aber Hans schien kaum an das eigene Eigenthum zu denken, seine ganze Aufmerksamkeit war dem Schutze des Deiches zugewendet, auf dem er commandirte. Er ließ, da es jetzt zu dunkeln begann, ein Feuer anzünden und die Mannschaft sich an demselben erwärmen, wobei jedem aus einem Fasse Branntwein ein nicht zu kleines Glas gereicht ward, aber nur das eine. Die Eismassen wälzten sich im dichtesten Gedränge die Weser herab, die fortwährend zu steigen schien.
Anmerkungen
Heinrich Albert Oppermann ist ein echtes niedersächsisches Phänomen: Er war Anwalt, Journalist, Parlamentarier, Landeshistoriker, Essayist, philosophischer und juristischer Schriftsteller, Nationalliberaler, Verfassungsfreund, kampfstarker Hannoveraner und obendrein noch Romancier. Zwei bemerkenswerte Romane nämlich hat er verfaßt - als junger Mann (unter dem bezeichnenden Pseudonym »Hermann Forsch«) die »Studentenbilder oder Deutschlands Arminen und Germanen in den Jahren 1830 bis 1833« und spät noch sein opus magnum, die »Hundert Jahre«, nach dem Diktum von Oppermanns Wieder-Entdecker Arno Schmidt »der einzige politische Roman der Deutschen«. Den ersten Entwurf des monumentalen Mehrtausendseiters veröffentlichte Oppermann seit etwa 1865, fortsetzungsweise, in dem von ihm herausgegebenen »Nienburger Wochenblatt«, die endgültige Fassung erschien 1870 bis 1871, bereits posthum, bei Brockhaus in Leipzig. Der Roman, in dem eine Reihe von Personen aus allen Ständen, Schichten und Klassen über drei Generationen hinweg (und durch drei Kontinente hindurch) verfolgt wird, beginnt im Hannoverschen, in der Grafschaft Hoya. In Hoya (das im Buch als »Heustedt« firmiert) hatte Oppermann seine erste Praxis als Gerichtsanwalt innegehabt - und somit seinerseits zu den »sogenannten Honoratioren« gehört, die im örtlichen Ratskeller verkehrten, wenn auch einige Jahrzehnte später, denn das obige Eisgang-Kapitel ist dem »Ersten Buch« des Romans (»Vor hundert Jahren«) entnommen und spielt im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. (Da Oppermann wie in all seinen Publikationen, etwa in seiner engagierten »Geschichte des Königreichs Hannover von 1832 bis 1860«, so auch hier ausgesprochen detailorientiert vorgeht, wurde die Passage leicht gekürzt...).
Quelle
Heinrich Albert Oppermann, Hundert Jahre. 1770 - 1870. Zeit- und Lebensbilder aus drei Generationen. (Mit einem Nachwort und vielfältigen Materialien von Heiko Postma), Ffm : Zweitausendeins, 1982, S. 234 - 260.