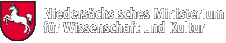Auf Heines Spuren in Goslar
Autor
Autorenportrait: Hans Christian Andersen

- 1831 -
Die Berge lösten sich nun aus ihrer Nebelgestalt und wurden zu großen, stolzen Massen, mit dunklen Tannenwäldern bewachsen, dazwischen wanden sich malerisch die Kornfelder, und vor uns lag Goslar, die alte kaiserliche Freie Reichsstadt.
Alle Dächer waren mit Schiefer gedeckt, was der Stadt, die von Bergen umschlossen ist, ein seltsam düsteres Aussehen verleiht. Hier war einst der Sitz der deutschen Könige und Kaiser, hier fanden Reichsversammlungen statt, hier wurde das Schicksal von Reichen und Ländern entschieden - heute, ja, heute ist Goslar durch sein Bergwerk und durch Heines »Reisebilder« bekannt. Hier spielte der Dichter Blumendieb und Herzensdieb - eine Geschichte, zu der sich die achtbaren Goslarer Bürger gar nicht bekennen wollen, sie zogen immer ein sehr saures Gesicht, wenn ich Heine nannte. Laßt mich deshalb ein bißchen vorsichtiger sein. [...]
Die Luft kam mir so merkwürdig drückend vor, ich konnte den Bergwerksduft ordentlich riechen, und der hat mit jenem etwas gemeinsam, mit dem sich, wie man sagt, der Teufel parfümiert, wenn er einen Ort im Zorn verläßt. Doch da ich den Teufel erwähne: bevor ich es vergesse, muß ich gleich erzählen, daß eine der ersten Sehenswürdigkeiten Goslar ein Präsent dieses berühmten Mannes ist. Mitten auf dem Markt befindet sich nämlich ein großes Becken aus Metall, das Rohre ständig mit Wasser füllen und das die Einwohner bei einer Feuersbrunst an Stelle einer Sturmglocke gebrauchen, indem sie darauf schlagen, so daß es in der ganzen Stadt zu hören ist. Dieses Gefäß, berichtet die Sage, hat der Teufel einmal bei Nacht hierhergebracht; ich rührte daran und fand, daß es eine äußerst solide Arbeit war.
Das Rathaus lag gleich in der Nähe, es war dunkel und altertümlich, all seine mächtigen Kaiser waren davor aufgestellt. Sie standen im ersten Stock, mit der Krone auf dem Kopf, dem Zepter in der Hand und waren stark illuminiert wie Nürnberger Bilder. Ich sah, wie ein alter Bergmann seiner kleinen Enkeltochter diese gewaltigen Helden zeigte; nun stellt sie sich alle Könige und Kaiser der Welt als solche ernsten Steinmänner mit Schwert und Krone vor, das kleine Vernunftwesen begreift schon, daß es kein Blumenleben ist, König zu sein und Nacht und Tag mit der schweren Krone vor dem Rathaus dazustehen und über Gesetz und Recht zu wachen.
Als ich durch die Straßen ging, sah ich an mehreren Häusern die Madonna mit dem Kind, oft war sie jedoch wie die Mauer überkalkt. Der Anblick dieser halbverfallenen Steinbilder, die mir wie Mumien eines entschwundenen Zeitalters erschienen, hatte für mich etwas Wehmütiges; auch sie haben einmal gelebt und geherrscht, obwohl sie diesem toten Stein entsprungen sind. Mir war auch, als flüsterten sie: »Es ist nicht mehr so wie früher, als sich Kaiser und Volk vor uns verneigten! Aber Goslar ist auch nicht mehr wie früher, mir und dem Kaiser ist hier die Krone vom Kopf gefallen!« [...]
Die Hauptkirche von Goslar ist abgerissen, nur eine Kapelle steht noch, und darin bewahrt man die Reste der früheren Herrlichkeiten der Kirche auf. Eine alte Frau führte uns hinein und erklärte uns diese Schätze. Gleich an der Tür war der heilige Christophorus in kolossaler Größe gemalt, wie er mit dem Jesuskind auf seinen Schultern im Wasser stand. »Das waren Leute damals!« sagte die alte Frau, denn sie glaubte, daß »der große Christoph« wirklich so lang und breit gewesen wäre, wie er hier aussah.
In einem offenen Sarg lag eine weibliche Figur aus Sandstein, man sagte, es sei die schöne Mathilde, eine Tochter Kaiser Heinrichs III. Sie war so schön, daß sich ihr eigener Vater in sie verliebte, und darum betete sie zu Gott, er möge sie mit einemmal recht häßlich machen. Da meldete sich der Teufel und versprach, die Liebe des Vaters in Haß zu verwandeln, wenn sie ihm auf ewig angehören wolle. Sie ging den Pakt ein, mit der Bedingung, daß sie davon befreit wäre, falls der Teufel sie bei seinen ersten drei Besuchen nicht schlafend fände.
Um sich wach zu halten, nahm sie Seide und Nadel und stickte nun ein kostbares Kleid, und ihr kleiner Hund Quedl saß dabei. Jedesmal, wenn sie einschlief und sich der Teufel näherte, bellte das treue Tier sogleich, und da war sie wieder wach und munter bei der Arbeit. Als sich der Teufel solcherart genarrt sah und nun sein Versprechen erfüllen mußte, fuhr er mit der garstigen Klaue über ihr Gesicht, drückte die schön gewölbte Stirn herab, machte die königliche Nase breit und flach, zog den kleinen Mund zu beiden Ohren und behauchte ihre schönen Augen, daß sie aussahen wie Blei und Nebel. Da wurde Kaiser Heinrich von Abscheu gegen sie ergriffen, sie baute sich eine Abtei, die sie nach dem treuen Quedl Quedlinburg nannte, und war dort selbst die erste Äbtissin.
Die alte Frau, die uns das Steinbild zeigte, wußte übrigens nicht recht, ob es Mathilde in den Tagen ihrer Schönheit vorstellte oder in der darauffolgenden Zeit, als der Teufel Hand an sie gelegt hatte; ich war eher für letzteres.
Auch der Kirchenstuhl Kaiser Heinrichs III. hat hier seinen Platz, ich setzte mich darauf und betrachtete nun die Bilder von ihm und den beiden andern Kaisern in den Scheiben des großen Kirchenfensters. Die Lichter spielten in der bunten Bemalung, und da sahen sie mir recht lebendig aus.
In der Mauer war eine alte Inschrift, die niemand von uns richtig zu deuten verstand. »Ja, wenn mein Bruder, der Doktor, hier wäre«, sagte mein Begleiter, »der würde uns alles, was da steht, erklären! Er ist ein gelehrter Mann, sehr gelehrt, ja« sagte er zu mir, »er ist genauso gelehrt wie Sie!«
Der Arme! dachte ich, aber ich sagte es nicht.
Anmerkungen
Im Mai 1831 ging der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen auf seine erste Auslandsreise - nach Deutschland, und dies durchaus auf den Spuren der romantischen deutschen Dichter, von denen er einige, Adelbert von Chamisso etwa (seinen ersten Übersetzer!) oder Ludwig Tieck auch persönlich traf. Der Hausgott seiner Jugend aber war Heinrich Heine gewesen, an dessen »Harzreise« sich Andersen denn auch auf diesem Teilstück seiner Tour nett ausrichtete. Der Harz selber aber wurde für ihn zum echten Erlebnis, zu seinem »Traumland der Phantasie«, vor dem selbst das bizarre Elbsandsteingebirge verblaßte: »Die Sächsische Schweiz ist interessant«, schrieb Andersen einem Freund, »aber nicht schön und grandios wie der Harz.« Hört man sicher gern, zumal im heinisch geschädigten Goslar.
Mehr zu Hans Christian Andersen - siehe unter »Lüneburger Heide«.
Quelle
Hans Christian Andersen, Schattenbilder von einer Reise in den Harz, die Sächsische Schweiz etc. etc. in Sommer 1831 (Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc. i Sommeren 1831) Hrsg. u. Übers. Gisela Perlet. In: Die frühen Reisebücher, Leipzig und Weimar : Gustav Kiepenheuer, 1984, S. 178 - 184