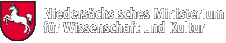Barthold Hinrich Brockes

Barthold Hinrich Brockes
* 22.09.1680 Hamburg
† 16.01.1747 in Hamburg
Vita
Barthold Hinrich (auch Heinrich) Brockes (sprich: brooks) war der Sohn einer reichen Hamburger Patrizierfamilie und zeitweilig Ratsherr der Hansestadt. Dank seiners Wohlstandes konnte er sich überwiegend seinen literarischen Interessen widmen.
Gemeinsam mit seiner Schwester erhielt er Privatunterricht durch seine Eltern, besuchte in Hamburg die Lateinschule und bildete sich durch Studien in Dresden und Prag fort. Später studierte in Halle Jura und Philosophie, unter anderem bei Christian Thomasius. 1704 schloss er sein Studium in Leiden mit der Promotion ab und erwarb sich den Titel des Lizentiaten der Rechte. 1714 heiratete er Anna Ilsabe Lehmann, mit der er zwölf Kinder hatte. 1720 wurde er zum Ratsherren gewählt, weswegen er mehrere diplomatische Reisen zu Höfen in Wien, Berlin und Glücksstadt unternahm.
Brockes war Mitbegründer der "Teutsch-übende Gesellschaft", die sich der Pflege der deutschen Sprache und Literatur zuwandte, und auch der "Patriotischen Gesellschaft", zu deren Zielen Gemeinnützigkeit, Offenheit und Toleranz zählen. Die Patriotische Gesellschaft war zugleich Herausgeber der Wochenschrift "Der Patriot", in der Brockes veröffentlichte und frühaufklärerisches Gedankengut verbreitete. Brockes übte verschiedene Ämter aus und wurde schließlich zum Kaiserlichen Pfalzgrafen ernannt. Sein ländliches Leben während seiner Amtmannzeit von 1735 bis 1741 in Ritzebüttel stand im Gegensatz zu seiner adeligen Lebensweise und vorigen Reisetätigkeit. Ritzebüttel zählte damals zu Hamburg und ist heute als Stadtetil Cuxhavens ein Teil Niedersachsens. 1741 kehrte Brockes nach Hamburg zurück. Der Ort Brockeswalde ist nach ihm benannt.
Brockes ist ein Dichter der Übergangszeit, der sich in seinen frühen Werken dem Barock verpflichtet fühlte, doch später auch Aspekte der Aufklärung aufnahm. 1712 veröffentlichte er das Passionsoratorium "Der für die Sünde der Welt gemarterte und Sterbende Jesus", das u.a. von Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Johann Mattheson und Georg Philipp Telemann vertont wurde. Ganz der Frühaufklärung hat sich Brockes mit seinen Gedichten "Irdisches Vergnügen in Gott", die in insgesamt neun Bänden erschienen, verschrieben. Schon zu seinen Lebzeiten erreichte das Werk eine hohe Popularität. In der Weltanschauung von der besten aller möglichen Welten begibt sich Brockes auf die Spuren der Theodizee-Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz: die Anerkennung der Schönheit und Nützlichkeit der Welt dient als Beweis Gottes. Andererseits sind die Gedichte auch als Lehrgedichte zu verstehen. Sie geben eine genaue Beschreibung der Natur, die bei ihm überhaupt einen bisher nicht erreichten Selbstwert erlangt. Seine Lyrik erfüllte so das Postulat des delectare et prodesse (d.h.: erfreuen und belehren) der Poetik des Horaz, der im 17. und 18. Jahrhundert am meisten rezipierten Poetik.
Zu Brockes weiteren Werken zählen auch Übersetzungen, unter anderem "Aus dem Englischen übersetzter Versuch vom Menschen des Herrn Alexander Pope" (1740) und "Aus dem Englischen übersetzte Jahreszeiten des Herrn Thomson" (1744).
Niedersachsen literarisch
| Titel | Erwähnte Orte | |
|---|---|---|
| Landleben in Ritzebüttel | Land Wursten | Details |