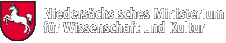Sprünge und kühne Würfe
- 1773 -
Über alte Volkslieder
Zuerst muß ich Ihnen also, wenn es auf Erfahrung und Autorität ankommt, sagen, daß Nichts in der Welt mehr Sprünge und kühne Würfe hat, als Lieder des Volks, und eben diese Lieder des Volks haben deren am meisten, die selbst in ihrem Mittel gedacht, ersonnen, entsprungen und gebohren sind, und die sie daher mit so viel Aufwallung und Feuer singen, und zu singen nicht ablaßen können. Mir ist z. E. ein Jägerlied bekannt, das ich wohl unterlaßen werde, Ihnen ganz mitzutheilen, weil sich das Meiste und Anziehendste in ihm, auf lebendigen Ton und Melodie des Horns beziehet; aber bei allem Simpeln und Populären ist kein Vers ohne Sprung und Wurf des Dialogs, der in einem neuen Gedichte gewiß Erstaunen machte, und über den unsre lahme Kunstrichter, also so unverständlich, kühn, Dithyrambisch schreien würden. Ein Jäger hat Abends spät das Netz gestellt, und bläßt alleweil bei der Nacht, (welche Worte die Jägerresonanz sind) mit seinem Horne das Wild aus dem Korn ins lange Holz : alleweil bei der Nacht begegnet ihm also von fern eine Jungfrau stolz, und da hebt sich dieser Dialog an:
Wo aus? wo ein? du wildes Thier!
Alleweil bei der Nacht!
Ich bin ein Jäger, und fang dich schier, u.s.w.
»Bist du ein Jäger, du fängst mich nicht«
Alleweil bei der Nacht!
»Mein’ hohe Sprüng’, die weißt du nicht«, u.s.w.
Dein’ hohe Sprüng’, die weiß ich wohl,
Alleweil bei der Nacht!
Weiß wohl, wie ich sie dir stellen soll u.s.w.
Und sehen Sie, plötzlich, ohne alle weitere Vorbereitung erhebt sich die Frage:
Was hat sie an ihrem rechten Arm?
und plötzlich, ohne weitere Vorbereitung die Antwort:
Nun bin ich gefangen, u.s.w.
Was hat sie an ihrem linken Fuß?
»Nun weiß ich, daß ich sterben muß!«
und so gehen die Würfe fort, und doch in einem so gemeinen, populären Jägerliede! und wer ists, ders nicht verstünde, der nicht eben daher auf eine dunkle Weise, das lebendige Poetische empfände?
Alle alte Lieder sind meine Zeugen! Aus Lapp- und Esthland, Lettisch und Pohlnisch, und Schottisch und Deutsch, und die ich nur kenne, je älter, je Volksmässiger, je lebendiger; desto kühner, desto werfender. Wenn Ihnen meine Skaldischen, und Lapp- und Schottländischen Lieder nicht gnug sind, hören Sie einmal ein andres, aus den Dodsleischen Reliques : ich wähle ein ganz gemeines, deren wir unter unserm Volk gewiß hundert ähnliche, und wo nicht Lieder, doch Sagen haben. Es ist nichts in der Welt mehr, als Sweet Williams Ghost : und doch, wie wenig kann ich ihm in der Übersetzung, seinen Aerugo, sein feierliches Populäres lassen.
Zu Hannchens Thür, da kam ein Geist,
Mit manchem Weh und Ach!
Und drückt’ am Schloß und kehrt’ am Schloß
Und ächzte traurig nach.
»Ists, Vater Philipp! der ist da?
Bists, Bruder! du, Johann?
Oder ists Wilhelm, mein Bräutigam!
Aus Schottland kommen an?«
Dein Vater Philipp, der ists nicht!
Dein Bruder nicht, Johann!
Es ist Wilhelm, dein Bräutigam,
Aus Schottland kommen an!
Hör, süsses Hannchen, höre mich,
Hör’ und willfahre mir!
Gib mir zurück mein Wort und Treu,
Das ich gegeben dir!
»Dein Wort und Treu geb’ ich dir nicht
Geb’s nimmer wieder dir!
Bis du zu meiner Kammer kommst,
Mit Liebeskuß zu mir!«
Zu deiner Kammer soll ich ein,
Und bin kein Mensch nicht mehr?
Und küssen deinen Rosenmund?
So küß ich Tod dir her!
Nein süsses Hannchen, höre mich,
Hör’ und willfahre mir.
Gib mir zurück mein Wort und Treu
Das ich gegeben dir!
»Dein Wort und Treu geb ich dir nicht,
Geb’s nimmer wieder dir!
Bis du mich führst zur Kirch’ hinan
Mit Treuering dafür!«
Und an der Kirche lieg’ ich schon
Und bin ein Todtenbein!
‘S ist, süsses Hannchen, nur mein Geist,
Der hier zur dir kommt ein!
Ausstreckt sie ihre Liljenhand
Streckt bebend sie ihm zu:
»Da, Wilhelm, hast du Wort und Treu,
Und geh, und geh zur Ruh!«
Und schnell warf sie die Kleider an
Und ging dem Geiste nach,
Die ganze lange Winternacht
Ging sie dem Geiste nach.
»Ist, Wilhelm, Raum noch, dir zu Haupt,
Noch Raum zu Füssen dir?
Ist Raum zu deiner Seite noch,
So gib, o gib ihn mir!«
Zu Haupt und Fuß ist mir nicht Raum
Kein Raum zur Seite mir!
Mein Sarg ist, süsses Hannchen, schmal
Daß ich ihn gebe dir!
Da kräht der Hahn! da schlug die Uhr!
Da brach der Morgen für!
»Ach, Hannchen, nun, nun kommt die Zeit,
Zu scheiden weg von dir!«
Der Geist – und mehr, mehr sprach er nicht
Und seufzte traurig drein
Und schwand in Nacht und Dunkel hin
Und sie, sie stand allein!
»Bleib, treue Liebe! bleibe noch
Dein Mädchen rufet dich!«
Da brach ihr Blick! ihr Leib der sank,
Und ihre Wang’ erblich! –
Nun sagen Sie mir, was kühn geworfner, abgebrochner und doch natürlicher, gemeiner, Volksmässiger seyn kann? Ich sage Volksmässiger : denn was die Bräutigamssitte betrift, lesen Sie die Gebräuche der Wilden, z. E. der Nordamerikaner; und das Kostume der Erscheinung, in seiner ganzen Natur, brauche ich Ihnen nicht zu erklären – künftig weiter!
... Sie glauben, daß auch wir Deutschen wohl mehr solche Gedichte hätten, als ich mit der Schottischen Romanze angeführet; ich glaube nicht allein, sondern ich weiß es. In mehr als einer Provinz sind mir Volkslieder, Provinziallieder, Bauerlieder bekannt, die an Lebhaftigkeit und Rhythmus, und Naivetät und Stärke der Sprache vielen derselben gewiß nichts nachgeben würden; nur wer ist der sie sammle? der sich um sie bekümmre? auf Strassen, und Gassen und Fischmärkten? im ungelehrten Rundgesange des Landvolks? um Lieder, die oft nicht skandirt, und oft schlecht gereimt sind? wer wollte sie sammlen – wer für unsre Kritiker, die ja so gut Sylben zählen, und skandiren können, drucken lassen? Lieber lesen wir, doch nur zum Zeitvertreib, unsre neuere schöngedruckte Dichter – Laß die Franzosen ihre alte Chansons sammlen! Laß Engländer ihre alte Songs und Balladen und Romanzen in prächtigen Bänden herausgeben! Laß in Deutschland etwa der Einzige Leßing sich um die Logaus und Scultetus und Bardengesänge bekümmern! Unsre neuen Dichter sind ja besser gedruckt und schöner zu lesen; allenfalls laßen wir noch aus Opitz, Flemming, Gryphius Stücke abdrucken. – Der Rest der ältern, der wahren Volksstücke, mag mit der sogenannten täglich verbreitetern Kultur ganz untergehen, wie schon solche Schätze untergegangen sind – wir haben ja Metaphysik und Dogmatiken und Akten – und träumen ruhig hin –
Und doch, glauben Sie nur, daß wenn wir noch in unsern Provinzialliedern, jeder in seiner Provinz nachsuchten, wir vieleicht noch Stücke zusammen brächten, vielleicht die Hälfte der Dodslei’schen Sammlung von Reliques, aber die derselben beinahe an Werth gleich käme! Bei wie vielen Stücken dieser Sammlung, insonderheit den besten Schottischen Stücken sind mir Deutsche Sitten, Deutsche Stücke beigefallen, die ich selbst zum Theil gehöret – haben Sie Freunde in Elsaß, in der Schweiz, in Franken, in Tyrol, in Schwaben, so bitten Sie – aber zuerst, daß sich diese Freunde ja der Stücke nicht schämen; denn die dreusten Engländer haben sich z. E. nicht schämen wollen und dörfen. Selbst die Melodie des Ihnen einmal angeführten Come away, come away, death! erinnere ich mich einmal dunkel gehört zu haben, und noch nicht vor langer Zeit erinnere ich mich eines Bettlerliedes, das an Inhalt so gemischt und voll Sprünge war, und in seiner sehr Lyrischen alten Melodie so traurig tönte. – Unter ihrem Jammer kam die Sängerin, eine Penia selbst, im halben Gebetston aufs Ende ihres Lebens, wenn sie der bittre Tod überwände, und ihr (ich glaube es ist Gewohnheit oder Ausdruck) die Füsse bände; endlich kämen 4 oder 6 Leute, die sie von Hause und Freunden weg, unter dem Schall der Todtenglocke, in ihr Grab trügen –
Und wenn die Glocke verliert ihren Ton
So haben meine Freunde vergeßen mich schon! –
Sagen Sie, ist der Zug nicht Elegisch und rührend?
Da ich weiß, daß dieser Brief keinem von den eckeln Herren unsrer Zeit in die Hände kommen wird, die über einen veralteten Reim oder Ausdruck gleich rümpfen! da ich weiß, daß Sie überall mit mir mehr Natur, als Kunst suchen : so trage ich kein Bedenken, Ihnen z. E. aus seiner Sammlung schlechter Handwerkslieder ein sehnend-trauriges Liebeslied hinzusetzen, das, wenn es ein Gleim, Ramler oder Gerstenberg nur etwas einlenkte, wie viele der Neuern überträfe! –
Der süsse Schlaf, der sonst stillt Alles wohl
Kann stillen nicht mein Herz mit Trauren voll.
Das schafft allein, die mich erfreuen soll!
Kein Speis’, kein Trank mir Lust noch Nahrung gilt,
Kein’ Kurzweil ist, die mir mein Herz erfreut,
Das schafft allein, die mir im Herzen leit!
Kein’ Gesellschaft ich nicht mehr besuchen mag,
Ganz einig sitz in Unmuth Nacht und Tag,
Das schafft allein, die ich im Herzen trag’.
In Zuversicht allein gen ihr ich hang’
Und hoff, sie soll mich nicht verlaßen lang,
Sonst fiel ich g’wiß in bittern Todes Zwang.
Ist das Sylbenmaaß nicht schön, die Sprache nicht stark, der Ausdruck empfunden? Und, glauben Sie, so würden sich in jeder Art mehrere Stücke finden, wenn nur Menschen wären, die sie suchten!
Anmerkungen
Johann Gottfried Herder, geboren, als Sohn eines Kantors, am 25. August 1744 im ostpreußischen Mohrungen, gestorben, als Generalsuperintendent, am 18. Dezember 1803 in Weimar, war von 1771 bis 1776 in Bückeburg als Hofprediger des Grafen von Schaumburg-Lippe tätig, dazu als Konsistorialrat und zuletzt auch als Superintendent. Ihm gefiel es dort ganz und gar nicht, und er versuchte beständig, andernorts eine Position zu erlangen, etwa als Professor an der Universität Göttingen, doch dazu hätte er einen Doktortitel vorweisen müssen, den er nicht besaß. Als er dann durch Goethes Vermittlung die Stellung in Weimar offeriert bekam, griff er sogleich zu, und damit endete seine niedersächsischen Geschichte.
Immerhin hatte ihm sein Bückeburger Amt soviel Zeit gelassen, daß er seine literarische Karriere weiterverfolgen konnte. Sein Drama »Brutus« entstand in dieser Zeit, genau wie seine Schrift »Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschen«. Vor allem aber betrieb er hier seine Studien zur Volkskunst, zumal zu den Volksliedern. Und er war es, der den Begriff »Volkslied« (in Analogie zum englischen »popular song«) überhaupt erst prägte - in Bückeburg! Mit der Veröffentlichung seiner ersten Sammel-Ergebnisse war er anfangs freilich etwas schamhaft : Einen druckfertigen Dokumentarband mit deutschen Volksliedern zog er wieder zurück, weil er fürchtete, man könne dergleichen einem Pfarrer als unwürdiges Treiben verübeln! Doch schließlich überwand er seine Bedenken, und 1773 verfaßte er für seinen Aufsatz-Band »Von Deutscher Art und Kunst« (an dem auch Goethe und Justus Möser mitschrieben) den Brief-Essay »Über Oßian und die Lieder alter Völker« – sein wortgewaltiges, programmatisches, mit zahlreichen Beispielen angereichertes Plädoyer für die Beschäftigung mit Volksliedern. Ein bahnbrechender Text – und geradezu eine heilige Schrift für die Romantiker-Generation um Clemens Brentano, Achim von Arnim, Joseph Görres, Jacob und Wilhelm Grimm, die dann tätig ins Werk setzten, was Herder hier angeregt hatte.
Quelle
Johann Gottfried Herder, Auszug aus einem Briefwechsel über Oßian und die Lieder alterVölker. In: Von Deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter (1773). Herausgegeben von Hans Dietrich Irmscher. Stuttgart : Reclam, 1968 [Auszüge: S. 39 – 45]
Publikationen
| Titel | Rubrik | Verlag, Verlagsort | Erscheinungsjahr | Erwähnte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Von Deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter (1773) | Hg. Hans Dietrich Irmscher | Reclam Stuttgart | #1968 | ###morelink### |