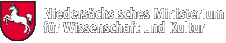O, man muß seine Fieber züchten!
- 1911 – 1912 – 1914 – 1921 -
Prosa – Kritik – Lyrik
PROSA
Der Tod und Stefan Wronski
Am Abend saß Stefan Wronski mit Pola, seiner Schwester, im Park auf der Bank. Vor ihnen schwieg der Kanal, schwarz, moorig und ohne Antwort. Die hohen Bäume waren sehr ängstlich geworden und versteckten sich im Dunkel. Nur die Birke, mit ihrem aufgelösten Mädchenhaar, schimmerte weiß, schlank der Verführung geneigt. Tote schwere Schiffe schwammen auf dem dunkeln Bett. Von irgendwoher kroch zitternd der Reflex einer gelben Laterne in die Wassertiefe hinein. Pola starrte vor sich hin, den Kopf in die Hände gestützt. Sie wünschte, sich in diese Finsternis aufzulösen, still zu vergehen, zu zerfließen... Stefan verstand sie. Er wollte sprechen. Ein Hustenanfall unerbrach ihn. Dann begann er doch :
»Siehst du, Pola : diese Minuten, in denen wir zu sterben wünschen – das sind die einzigen, um derentwillen es sich zu leben lohnt. Herr von Hofmannsthal, in einem seiner schönsten Gedichte, spricht von solchen Stunden, wo wir den Tod verstehen, ›so leicht und feierlich und ohne Grauen, wie kleine Mädchen ... an einem Abend stumm vor sich hinsehen und wissen, daß das Leben jetzt aus ihren schlaftrunkenen Gliedern still hinüberfließt in Bäum’ und Gras ...‹ Nur um dieser todesschönen Sehnsucht willen existiere ich noch. Wenn ich Reisen zu machen scheine, wenn ich im Café américain in schön geschminkten Augen untertauche, wenn ich hingehe, wo – mit Rimbaud zu reden – ›les orgies pleurent leur râlé aux anciens lupanars‹, wenn ich zuweilen ein Theater besuche – so ist das alles, alles nur ein Suchen nach jenen letzten, wilden und traurigen Schönheiten, mit denen mein Tod – unser Tod, Pola – geschmückt sein soll. Die späten, irren Feste suchen wir – die äußerste enthusiastische Geste, das souveräne Herrscherbewußtsein, jenseits der lächerlichen Registratur bürgerlicher Ästhetik!«
Stefan hustete gequält auf. Das Haar hing ihm wirr in die Stirn. Er ward erregter:
»Da haben sie das Theater und glauben, es müsse ihnen gute oder böse, objektive Werte bieten. Für mich ist das Theater, auf der Reise à travers les sensations, nichts als eine abenteuerliche Station. Ein Abenteuer, ein Versteck, ein Traum, ein Fieber ... O, man muß seine Fieber züchten! ... Manchmal kommt man aus der Angst und steigt die helle Freitreppe hinauf, wo soviel Erwartung, Bereitschaft, Hingabe, Röckerascheln und Schleierwehen sich drängt! Und dann löst sich alle Qual in der idiotischen Banalität irgend eines kassenfüllenden Lustspiels ... Ob aber die Stücke gut oder schlecht sind, ob die Spieler göttlich oder schweinisch – das ist mir vollkommen einerlei. Es kann geschehen, daß mich die himbeerfarbene Schleife im hellen Haar irgendeiner kleinen Statistin stundenlang bannt, eine dumme, alberne Schleife, auf die ich hypnotisiert hinstarre, solange das Mädchen auf der Bühne bleibt. Geht es dann weg, so scheint mir das Drama plötzlich so unsagbar traurig, wertlos, seines einzigen tröstlichen Farbfleckes beraubt ... Einmal aber, Pola, soll mir das Theater die letzte, große, majestätische Erregung schenken, die Synthese von Sehnsucht und Erfüllung, von Haß und Liebe, von Lust und Ruhe! O, er soll mir den Tod schmücken helfen, dieser Abend, auf daß das Ende voll sei aller grandiosen, schmerzhaften Überwindungen, die uns in diesem armen Leben gelungen sind. Ich will nicht und ertrage es nicht, daß mein Tod nur die verächtliche Konsequenz des Lebens sei; nein : die Süße von tausend weit auseinanderliegenden Katastrophen, Grotesken und Sentimentalitäten will ich in ihn hineinpressen! ... An diesem Abend aber soll man ein Stück von Stanislaw Przybyszewski spielen. O, ich liebe ihn (ich bin sein Geschöpf), seinen furchtbaren Fatalismus, sein mittelalterliches Flackern, das Pathos seiner Zerstörungssucht und seine Angst, seine urewige, unentrinnbare Lebens- und Todesangst! Die ist der dunkle Grund der Seele, aller Seelen! Und in diesem Stück, das ich mir dunkelbraun, grauenvoll und verzweifelt denke, sollen bleiche Gesichter in die leere Weite starren, mit halben zerfetzten Worten, mit trostlosen Gebärden, in schleichender Verdammnis. Große Augen leuchten im tückischen Rausch des Vergehens. Eine weiße Hand legt sich auf einen schwarzen Scheitel. Die Worte rinnen und flüstern und plätschern, wie Tropfen einer boshaften Flüssigkeit. Nur noch die Angst ist da und ihr steiler Herr, der Tod. O, in dieser Symphonie eines dämonischen Pessimismus soll mir ruhig und leicht werden! Kennst du die Bilder von Eugène Carrière, diese braunen Dunkelheiten, hinter denen ein bleiches, krankes Muttergesicht sich verliert? ›On y a éteint le gaz‹, spotten die Franzosen. So soll diese letzte Szene sein ... Und dann, still und befreit, nehme ich dich bei der Hand, den diamantnen Weg, den wir nicht mehr durch die Trivialität eines Worts entweihen wollen ... Herr Peter Altenberg erzählt, er habe, nach der ›Götterdämmerung‹, die Geliebteste in seine liebevollen Arme nehmen müssen, um ein Uhr nachts; es sei nur die ›Fortsetzung‹ gewesen. He, he! ... Unsere Fortsetzung, unser letzter Triumph, dem das Theater dienstbar sein mußte, das ist der heilige, alles überwindende, große, göttliche Tod, Ende er und Anfang! ...«
... Stefan Wronski ist ein sehr zerrütteter Lump mit einem peinlichen Stich ins Kolportagehafte.
[Die Aktion, 7. August 1911, Sp. 786f]
KRITIK
Zu Stanislaw Przybyszewski: »Das goldene Vließ«
Matinée der Neuen Freien Bühne in den Kammerspielen (Berlin)
Diese Tat des Herrn Karl Vogt : auf seiner Szene Przybyszewskis Dramenzyklus »Totentanz der Liebe« aufzuführen, erfüllt mich mit tiefer Achtung und mit einer wilden Freude. Denn das Theater Przybyszewskis, das Theater der Qualen, der Neurosen, Psychosen, der Gewissensängste, der Reue und des Todes, bietet radikal und fanatisch das, worauf es ankommt. O, es ist ein ehrliches Theater. Vom Schwindel heutiger Weltanschauungsharmonie, der »neuen Moral«, der Aufgeklärtheit monistischen Männerstolzes und naturwissenschaftlich geblähter Tribünenpathetik bleibt es weltenfern – so fern, wie die Heiligkeit des Mittelalters von der öffentlichen Gemeinheit der Moderne entfernt ist. Deswegen heult die Presse auf, sowie man ihr Przybyszewski zumutet. Nie wird sie so aufrichtig böse, als wenn sie, ein paar Akte lang, auf ihre Abstammung vom Affen und auf die, von Hygiene und Selbsterhaltung beanspruchte Langeweile verzichten soll. Bis heute ist’s der Presse hübsch gelungen, den Deutschen das Werk Przybyszewskis zu unterschlagen. Wußte sie, was dieser Dichter, 1895, in einer Vorrede zu seinem Buche »De profundis« über den Materialismus und alle süßen Errungenschaften geschrieben hatte, die uns zur Anbetung serviert werden, wo immer aus Abendausgabe und Morgenausgabe ein neuer Tag wird? Sie wußte es nicht – denn sie ist nicht einmal »informiert« : nicht einmal in ihren Niederungen korrekt -; nur witterte sie, mit Detektivinstinkten, in dieser Art Literatur den Feind – all das Verhaßte : den integralen Pessimismus, die hieratische Unerbittlichkeit des Katholizismus und die heilige Allmacht der Seele (deren Existenz von den Fortgeschrittenen durch Warmwasserversorgung und Aeroplane ersetzt worden ist). Aber gemach – : wir sind dieser Tyrannei der Toleranten, der lächerlichsten und langweiligsten Schreckensherrschaft, die je aus Tintenfässern erblühte, sehr müde; und achselzuckend werden wir uns ihrer erwehren. Die Zeichen häufen sich. Unsere Vorhut hat die Seele zurückgerufen. Ein Ekel vor protoplastischer Gedunsenheit ist in allen guten und entschlossenen Büchern, die heute erdacht werden. Die Presse, aufgeschreckt, wird sich an den sechzigjährigen Blumenthal klammern. Wir werden sie gar nicht mehr beachten. Sie ist erledigt. Und es wird, was in seelischen Ländern längst geschehen ist, auch in Deutschland die Zeit Dostojewskis, Przybyszewskis und der Mystiker anbrechen, der Demut und der Empörung, die Zeit der Tiefe und des Untergangs. Am Ende wird selbst die Presse das registrieren (sie hat sich an vieles gewöhnen müssen). Aber das wird dann sehr gleichgültig sein. Wie schon heute ihr immerwährender Witz : Verästelten die Kaltwasserheilanstalt anzuraten, nur traurig wirkt und abgeschmackt. Dichter, die um Leiden wissen, heißen diesen Optimisten egoistisch und weltfremd. Den Sonnigen sei immerhin verraten, daß Przybyszewski als Arzt begann, während der Epidemie in Hamburg Cholerakranke pflegte, und daß er dann in die Politik ging und Redakteur der »Gazeta robotnicza« wurde, der sozialistischen polnischen Arbeiterzeitung in Berlin. Aber jene Wänste werden fortfahren, in ihren Paradiesen (unter dem Strich) Fulda zu hätscheln und Schönherr und Hardt und Rö... doch es ermüdet mich, solche Namen aufzuschreiben. Alles, was erhaben ist und erlitten und jenseitig : das bleibt uns allein : uns : den Unmodernen, den Zurückgewandten, den Neurasthenikern und Dekadenten.
[Die Aktion, 18. März 1912, Sp. 367f]
LYRIK
Wir Gespenster
Leichtes Extravagantenlied
Wir haben all unsere Lüste vergessen,
In Cinémas suchen wir Grauen zu fressen;
Erleuchtete Tore locken uns sehr,
Doch die Angst ist gering – wir brauchen viel mehr.
Als Knaben sind wir ins Theater gegangen,
Nach gelben Aktricen ging unser Verlangen;
Nur Herr Kerr geht noch hin, gegen Wunder geimpft,
Der Nietzsche und Strindberg als Scherlschelm beschimpft.
Für Haeckel-Empörungen dankten wir bestens,
Da flohen wir zitternd ins Café des Westens
Zu heiligen Frauen. Es gibt auch Hyänen,
Die scharren nach goldenen Löwenmähnen.
Aus der Zeit Przybyszewskis sind wir hinterblieben :
Gespenster, die Lautrec und Verzweiflung lieben.
Wir haben nichts mehr, was einst wir besessen,
In Cinémas suchen wir Grauen zu fressen.
[Die Aktion, 24. Januar 1914, Sp. 80]
ZWEIFEL
Darf solcher Traum mir je verblassen?
Das Fieber, das du mir gelassen,
Soll mich in hohe Grade werfen,
Ich will es mit Bewusstsein schärfen.
Wie fraglich, ob ich DICH gehalten :
Die letzte deiner Scheingestalten!
War das (im crême und erdbeer Lichte)
Das wesens-nächste der Gesichte?
Du sprangst aus kirschenroten Hosen –
Als ... purste der Metamorphosen?
Und bildetest, mit kleinem Fächeln,
Ein schmales, rätselhaftes Lächeln.
Wem gibst du (jetzt ...) die tiefste Stunde?
Den wahrsten deiner tausend Munde?
Mir bleibt der Tic, dir nachzutasten –
Mit Händen, die ... dich jemals fassten?
DIE ANTWORT
In allen meinen Scheingestalten
Bin ich nicht Schein : bin ich enthalten!
Ist starr, was strahlt und weht im Lichte?
Wahr ist nur Wandlung der Gesichte.
Es blieb mein Mund bei deinem Munde,
Zutiefst bewahr’ ich unsre Stunde,
Und bin geschmiegt in euer Tasten,
O schöne Hände, die mich fassten
[»Privatgedichte«, 1921]
Anmerkungen
Ferdinand Hardekopf wurde am 15. Dezember 1876 im oldenburgischen Varel geboren, besuchte das Gymnasium in Oldenburg, absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und kam 1900 als Reichstags-Stenograph nach Berlin, wo er bis 1916 im Kreise der »Aktions«-Literaten hängenblieb. Seinen Heimatort Varel hat er in einer seiner Publikationen eher schnöde (wenngleich sprachlich eindrucksvoll!) beschrieben : als eine »jener Siedlungen, in denen es nach Nordseekrabben und kleinbürgerlicher Achtbarkeit riecht, deren Straßen vom beizenden Rauch des Moorbrennens verdüstert sind, und die beanspruchen, am Meere zu liegen, während man doch weit wandern muß, ehe man den Jadebusen entdeckt : diese bescheidene Filiale, die bei Ebbe nichts als eine trübe Ewigkeit feuchten Schlammes ist.«
In Berlin war Ferdinand Hardekopf einer der prägenden Autoren in Franz Pfemferts Zeitschrft »Die Aktion«, in der er gelegentlich auch unter seinem Pseudonym »Stefan Wronski« schrieb : 1916 etwa verfaßte er als Stefan Wronski die »Erste Proklamation des Aeternismus«. Er verkehrte bevorzugt im Café des Westens (dem »Café Größenwahn«), wo sich Literaten wie Kurt Hiller, Ludwig Rubiner oder René Schickele trafen, wo vor allem der ungeheuer prägende Dramatiker, Essayist und Romancier Stanislaw Przybyczewski (1868 – 1927) den Ton angab : Er stammte aus Polen, hatte in Berlin Architektur und Medizin studiert, war mit Strindberg befreundet und übte seiner Dicht- und Denkweise, mehr noch seiner radikal antibürgerlichen Lebenshaltung wegen einen kaum vorstellbaren Einfluß auf seine literarischen Jünger aus, wie nicht zuletzt die obigen Hardekopf-Texte aus dieser Phase zeigen.
1916 verließ der entschiedene Kriegsgegner Hardekopf Berlin und ging in die Schweiz, wo er sich im Zürcher Café Voltaire dem dortigen Dadaisten-Zirkel anschloß. Nach Kriegsende kehrte er, 1921, kurz nach Berlin zurück, wo er das Kabarett »Größenwahn« gründete; doch von 1922 an hielt er sich – gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sita Staub – vorwiegend in Frankreich auf. Nach 1933 staatenlos geworden, wurde er zur Zeit der deutschen Besetzung, in französischen Lagern interniert, wobei in den Wirren der Koffer mit den Skripten seines geplanten Hauptwerkes verloren ging – »Die Dekadenz der deutschen Sprache«. Nach Ende des 2. Weltkrieges zog er in die Schweiz, wo er sich fast ausschließlich dem Übersetzen französischer Literatur widmete. Am 24. März 1954 ist Ferdinand Hardekopf in Zürch gestorben.
Quelle
Ferdinand Hardekopf, Der Tod des Stefan Wronski. – Theater. – Wir Gespenster. In: Ich schneide die Zeit aus. Expressionismus und Politik in Franz Pfemferts »Aktion« 1911 – 1918. Herausgegeben von Paul Raabe. München : dtv, 1964, S. 30ff, S. 59f, S. 162.
Ferdinand Hardekopf, Privatgedichte. München : Kurt Wolff, 1921 (Bücherei »Der Jüngste Tag«, Band 85), S. 7 und 8. (Neu herausgegeben und mit einem dokumentarischen Anhang versehen von Heinz Schöffler, Ffm : Scheffler, 1970, Band 2, S. [1491 und 1492]
Publikationen
| Titel | Rubrik | Verlag, Verlagsort | Erscheinungsjahr | Erwähnte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Ich schneide die Zeit aus. Expressionismus und Politik in Franz Pfemferts »Aktion« 1911 – 1918 | Hg. Paul Raabe | dtv München | #1964 | ###morelink### |
| Privatgedichte | Kurt Wolff München | #1921 | ###morelink### |