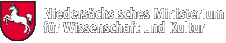Im Dunstkreis von Pyrmont
- 1806 bis 1824 -
Lyrik und Prosa
HERBSTLIED
O, Bild des Todes, herbstliche Natur,
Natur, beraubt vom lichten Frühlingskleide,
Wer wehte Todeshauch auf deine Flur
Und nahm ihr kalt das schöne Glanzgeschmeide? –
Rings um mich her fast alles ausgeblüht.
Der Aster letztes Blättchen welkt hernieder;
Kein Veilchen duftet, keine Rose glüht,
Und ach! kein milder Hauch erquickt sie wieder –
Verödet, wie in stiller Todtengruft,
Herrscht rings in allen Thälern Grabesstille.
Kein froher Haingesang durchtönt die Luft,
Kein Laut durchbricht des langen Schlummers Hülle.
Nackt liegt der Hügel, kahl und fahl der Hain;
Statt lauter Sänger, fröhlichem Geschmetter
Rauscht, wie des starren Todes dürr Gebein,
Nur schauerlich Geraßel, welke Blätter.
Du trauter Wald! vor wenig Wochen noch
Da ruht’ ich süß in deinem kühlen Schatten, –
Als noch die Nachtigall um deine Zweige flog,
Noch Blumen blühten in den grünen Matten.
Jetzt treibt der nahe, reifbedeckte Bach
Von deinem langgeblühten Frühlingskleide
Ein welkes Blatt dem andern eilend nach,
Und rauscht, starrathmend durch die dürre Weide.
Verhüllt hat sich der Morgensonne Licht
Im kalten dichtgewebten Nebelschleier,
Den sie am vollen Mittag nur durchbricht,
Zu schauen rings die stille Todtenfeier.
So schwindet alles, jeder Reiz entflieht; –
Ach – gleich der Schönheit einer Frühlingsrose,
Zerfällt auch diese Hülle und verblüht
In der Verwesung dunkl’en Moder-Schooße.
Ach kann der Mond, der jetzt den Wald durchrauscht,
Nicht bald schon meines Grabes Blumen knicken?
Kann Lunens Licht, das lebend mich belauscht,
Nicht morgen schon auf meine Bahre blicken?
O Herbst, wenn, wiederkehrend dann dein Hauch
Schon meines Grabes Todtenkranz zerpflückte,
Dann finde dort ein kleines Blümchen auch,
Womit des Edlen Hand den Hügel schmückte.
Im Herbst
1806
[Publ. 1810 in der Zeitschrift »Mimigardia«]
EINE BADEREISE NACH PYRMONT IM JAHRE 1824
Die lang besprochene Reise beginnt. A. hat mit größter Emsigkeit Frau und Schwägerin, Koffer und Schachteln verpackt, keine Nadel und kein Schnürband vergessen. Ein Wagen, der für sechse Raum hat, nimmt die 90-pfündigen Frauen auf, die neben der einzigen Schachtel wie in Abrahams Schoße sitzen. Noch ein Lebewohl Mann, Schwester und Kind, und rasselnd geht’s zum Tore hinaus. [...]
Auf dem Weg von Lemgo nach Pyrmont wird die Gegend immer schöner, die Ansichten immer erhabener. Einzelne Partien Kornfelder wie ein wogendes Meer, hoch am Berge, wie von grünen Waldufern umschlossen, tiefe Schluchten, in denen wohlgenährte Kühe und Ziegen weiden, herrliche, hier und da von rauschenden Bächen durchschnittene Täler, wo die fleißige Bleicherin am Ufer des Baches die Leinwand gießt, bieten einen unaussprechlich reizenden Anblick.
Hier und da steigen die Berge bis in die Wolken hinauf, bis unser Weg auf einen der schönsten hinauf und so steil hinab führt, daß wir zu gehen genötigt sind. Tief unter uns sehen wir ein Tal, das überall von schönen Pappelpyramiden ebenmäßig durchschniten wird, ein Fußsteig führt an dem ein paar Häuser tiefen Fuhrwege her. Wir wandeln ihn, ganz in Anschauen und Genuß versunken, und erblicken plötzlich am Abhang eines Berges ein Städtchen, ganz in Grün versteckt.
»Was ist dies, Fuhrmann?« – »Pyrmont.« – »Was, dies kleine Ding, wie ist das möglich?« Verwundert blicken wir uns an, und keiner will dem andern gestehen, daß seine Erwartungen betrogen sind. Schweigend steigen wir wieder ein, und erreichen ein schlechtes, erbärmlich gebautes und gepflastertes Dörfchen, die Hütten tief in Grün versteckt. Sind wir in Pyrmont?
Nein, Holzhausen, zehn Minuten davon. Wir atmen wieder auf. Schon wird der Wagen von Kindern belagert. Sie reichen Rosen, wilde Blumen und Eichenblätter in Ermangelung eines andern hinein. Der Schwager macht Miene, sie auseinanderzujagen : »Dat könn wi sölvst wull plücken.« Bis wir ihm hier wenigstens die Herrschaft nehmen, und den Kindern zum Zwecke verhelfen.
Das Dörfchen ist zu Ende und Pyrmont erreicht. An der Barriere fragt man uns, ob wir Zimmer haben, und zeigt uns deren an, da es nicht ganz voll ist.
Hier beginnen schöne Gebäude, eins am andern, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, alle sind von Linden umschattet und Fenster, Treppen und Altan reich mit Blumen garniert, ebenso das fürstliche Schloß, ein stattliches hochliegendes Gebäude, überall von den herrlichsten in- und ausländischen Gewächsen umstanden.
Jetzt beginnen die ersten inneren Herrlichkeiten Pyrmonts sich vor uns auszubreiten. In einem großen Bassin entströmt einem Schwanenhalse ein hoher, immer plätschernder Springquell. Diesem gegenüber, am anderen Ende der großen Lindenallee, befindet sich der Behälter, wo die Nymphe des Quells ihren reichen Segen spendet.
Es ist Mittag und daher jetzt alles ziemlich leer und die Bevölkerung jetzt mehr an den Fenstern, auf Terrassen und Altanen lustwandelnd das Mittagsmahl im Freien einnehmend zu sehen.
Wir gelangen an unsern Gasthof, werden bald mit dem Wirt einig und akkordieren eine hübsch möblierte, an der Straße befindliche Stube mit zwei Betten zu fünf Reichstalern wöchentlich. Die Miete macht den teuersten Artikel, alles übrige ist billig; und wir finden, daß, wer auf das Notwendigste sich beschränken, hier äußerst wohlfeil und wer etwas mitnehmen (mitmachen) will, doch nicht kostbar zu leben braucht.
Nach eingenommenen, für 8 gute Groschen die Person, sehr reichem Mittagsmahl, gehen wir, nachdem Koffer und Schachtel ausgepackt, in die große Allee, wo man nachmittags den Kaffee einzunehmen pflegt. Hier strömt die schöne Welt in bunter Menge auf und ab, zu sehen, gesehen zu werden, zu hören, zu genießen. Alles, viele Menschengesichter ausgenommen, ist schön, worauf die Blicke sich wenden. Die geschmackvollen Anzüge der Damen mit denen die Torheit ihr buntes Spiel treibt, aus allen Enden der Welt zusammengetragen, Brillanten, Straußenfedern, Gold, Silber, Seide, Tuniken, Hüte, Turbane, Spitzen, Flor und Bänder, Taillen und Füßchen eingeschnürt, daß man’s nicht ansehn mag – das Auge ermüdet von all der Pracht und kann mit Vergnügen selbst auf den Kindern nicht verweilen, die die noch größere Elterntorheit steif geputzt in türkischen, englischen und weiß der Himmel was für Anzügen mitunter mit ganz entblößter Brust und Schultern zur Schau stellt – oh Verkehrtheit! Bleiche kranke Gesichter sieht man wenige. Nur wo geringe schlecht gekleidete Menschen uns begegnen, sieht man Krankheit.
Längs der Allee liegen die stattlichsten Gebäude, Ball-Schauspiel-Cafe- Restaurationshaus, Buchläden und die herrlichsten Warenlager aller Art. Hier muß man durchaus die Augen zudrücken und mit stoischem Gleichmut vorübergehen, sonst kann man der Versuchung, sich hier für des Mannes sauer erworbenes Geld etwas von all den Herrlichkeiten anzueignen unmöglich widerstehen, und es ist doch lauter Luxus, lauter entbehrliche Sachen und alles ist hier, wie leicht zu begreifen, wenigstens 10 Prozent teurer als anderswo. Nur ein Hut von einem uns als billig rekommandierten Putzhaus in Leipzig, bei dem man unter hunderten die Wahl hat, wird als unentbehrlich gekauft. Kaum bestellt, wird schon der Kaffee gebracht. Die Damen arbeiten dabei, und man läßt die schöne Welt an sich vorüber wandeln. Zwei hochrot geschminkte, frech blickende Frauenzimmer fallen uns auf, und Modeste und ich sprechen zu gleicher Zeit unsere Meinungen über sie aus, wir erkundigen uns, aber o Irrtum, es sind ein paar Hofdamen der abwesenden Fürstin von Waldeck. So kann man sich irren, derartige Geschöpfe, wie wir in ihnen vermuten, werden hier garnicht geduldet. Sie verbergen sich in dem Dörfchen Holzhausen und dürfen vor allen Dingen in der Allee sich nicht blicken lassen.[...]
Abends 8 Uhr, welche Stunde mit der Glocke angedeutet wird, geht fast alles zur Restauration. Hier sind zehn bis zwölf große Tische gedeckt, worauf man das Verzeichnis der zu habenden Speisen findet, und für 3 bis 5 gute Groschen ißt man in einem herrlichen Saale, in glänzender Gesellschaft auf schönen Gedecken und bei Wachslichtscheine satt, d.h. wenn man nicht gar zu großen Appetit hat. Wir fanden im Verzeichnis selbst Hirschbraten, Sardellenfilets usw. Ermüdet von all der Herrlichkeit gehen wir nach Hause und zu Bett, und bestellen uns am andern Morgen den Arzt, ihn wegen der Kur zu Rate zu ziehen. Herr Rat Mundhenke, der Sohn unseres Wirts, ist ein freundlicher sanfter Mann und sagt mir, nachdem ich ihm gesagt, welche Ursachen die Ärzte meiner Körperschwäche zugrundelegen, alles vor, was mir fehlt, Kopfschmerz, Neigung zum Schweiß, Schwellen der Füße etc. Er verspricht mir vom Bade gute Wirkung, verbietet aber während der Badezeit alles Obst, das so herrlich hier zum Kaufe geboten wird. Da muß man nun einmal wieder bloße Vernunft sein, sogar Salat darf nicht genossen werden. Er wird deshalb auch nirgends gereicht.
Wir haben Sonntag und gehen deshalb zur einzigen Messe, wozu ein auswärtiger Geistlicher hierher kommt, und die im Ballsaal gehalten wird. Das Lokal ist zwar sehr anständig, jedoch thront Apoll mit der Leier über dem errichteten Altar und man kann sich bei diesem Anblick kaum des Lächelns erwehren, nur froh, daß nur schlecht gekleidete Menschen in der Messe – Katholiken scheinen wenige hier zu sein. [...]
Am andern Morgen wallfahrten wir zum ersten Mal zum heiligen Brunnen nachdem das schon um 3 bis 4 Uhr beginnende Leben auf den Straßen uns zeitig geweckt hatte. Um 5 Uhr sieht man schon Gäste um den Brunnen versammelt, hier reichen schöpfende Männer in dem von jedem Gaste ihnen dargebotenen Glase das helle, perlende und sehr wohlschmeckende Wasser, wovon wohl etwa die Hälfte genossen und der Rest in marmorne Rinnen gegossen wird, die mit Kanälen in Verbindung stehen, welche diese hinwegführen. Die herrlichste Musik, die bis um 8 Uhr spielt, erleichtert das Gehen in der Allee während des Trinkens, nur ist diese, da sie dicht beschattet ist, sehr kühl, und wir bedauerten sehr die Unbesonnenheit, nicht wie die übrigen Damen unsere Wintermäntel mitgenommen zu haben. Die Bäder sind in den Morgenstunden, weil sie der Bequemlichkeit halber dann am meisten gesucht werden, sehr selten zu haben, und wir müssen uns bequemen, entweder morgens 6 Uhr oder nachmittags zu baden, zogen indessen ersteres vor.
Den fürstlichen – allen Badegästen mit dem Vorbehalte nichts zu pflücken oder zu beschädigen offenen – Garten besuchten wir an diesem Tage und fanden darin unter andern herrlichen Blumen eine vorzügliche Auswahl verschiedener Rosen, die Rose Triumphante, Sanglante, Touchante, Admirable, Aimable, Noire de Diable, Passalbe etc. Auch herrliche Monatsrosen im Gartenboden zu hohen Stauden herangewachsen, die herrlichsten Stachel-, Erd- und Johannisbeeren mußten wir des fürstlichen und ärztlichen Gebotes wegen leider unberührt lassen. [...]
Auf dem Brunnen, woraus das Wasser in die Bäder geleitet wird, sehen wir auf den darüber befestigten Bänken viele Landsleute sitzen und erfahren, daß dies teils zum Vergnügen, teils zum Nutzen geschehe, weil der daraus hervorsteigende Dampf stärkende Kräfte habe. Hält man eine Ente oder ein Huhn eine Zeit lang über den Brunnen, so wird das Tier leblos und erholt sich nur wieder in gewöhnlichem Wasser, legt aber dann nie ein Ei wieder. Aus diesem Brunnen wird das Wasser in die Buden geleitet, und man sieht ihn den ganzen Tag von Fässern, Eimern und von Schöpfenden umgeben, die das Wasser zu Privatbädern holen. Das Wasser in dem Trinkbrunnen vermindert sich übrigens durch alles Schöpfen nicht, obgleich täglich im Durchschnitt 4 000 Krüge zum Versenden daraus gefüllt werden. [...]
Heute verlebten wir einen sehr schönen Nachmittag in Holzhausen, wohin wir in großer Gesellschaft gegangen waren. Eine schöne Allee führt von Pyrmont gradewegs zu dem Dörfchen, das ich beim Durchfahren für Pyrmont selbst gehalten hatte. Ein mit schönen Stuben, Säulen und Gärten versehenes Wirtshaus nimmt die dahin Wallfahrenden auf. Man speist und tanzt auch wohl hier, und wir fanden auch jetzt Musik und Tanzende, nahmen aber keinen Teil am Tanz, weil das Tanzen der Kur sehr nachteilig ist.
Die Jodfälle sind ebenfalls in der Nähe von Holzhausen, und wir nahmen sie abends in Augenschein. Wirklich eine furchtbare Tiefe von der man bei dem Größten bis auf den Wasserspiegel hinabschaut, von wo man bis auf den Grund 30, bei den andern aber 200 – 300 Fuß mißt. Eine ungeheure Tiefe also, in der, wie uns die hier überall stehenden und die Hand nach einer kleinen Gabe ausstreckenden Cicerone erzählten, schon mancher frei- und unfreiwillig seinen Tod fand. Ein Badegast, ein Franzose, den einer aus unserer Gesellschaft gekannt hatte, hat sich, man weiß nicht warum, und ein Mädchen unglücklicher Liebe wegen ertränkt, wie uns der Führer, der kaum zu wissen schien, was Liebe sei, sehr rührend erzählte. Die Jodfälle verdanken überwiegend ihre Entstehung unsichtbaren Naturprozessen, welchen, darüber sind die Meinungen der Forscher geteilt.
Die bekannte Dunsthöhle sahen wir ebenfalls, sowie die Wirkungen dieses ganz unsichtbaren, aber desto fühlbareren, heute nur drei Fuß über dem Boden stehenden Dunstes, in dem jedes Feuer erlischt, jedes lebende Geschöpf bewußtlos und endlich tot hinsinkt. Wir sahen dies an einem Raben, der binnen einiger Minuten sich wälzend und nach Luft schnappend taumelnd dahinsank, bis er sich, herausgebracht, nach und nach erholte. Wir versuchten, den Kopf in den Dunst zu halten, aber wie von einem elektrischen Schlage fuhr man von dem Dunste berührt, in die Höhe. Diese Höhle hat gewiß schon mancher Selbstmörder zu seiner Ruhestatt ersehen. Die Führer erzählten uns Beispiele, die vor nicht langer Zeit sich ereignet haben sollen.
Übrigens ist es nicht möglich, das Mindeste zu sehen, auch mit Hilfe des Mikroskops soll man den Dunst durchs Auge nicht wahrnehmen können. Den einzig schönen, ganz warmen stillen Abend wurde im Grünen gelagert, ein fröhliches Danklied zum Opfer gebracht, und man trennte sich, froh des stillen Genusses, ohne zu bereuen, den »Bräutigam von Mexiko« nicht besucht zu haben. Die Stunde des Schauspielanfangs verrinnt hier immer unbemerkt, und eh einer sich’s versieht, ist es zu spät, und man kann sich von dem Genusse eines schönen Abends nicht trennen, um ins finstere Schauspielhaus zu gehen. [...]
Die letzten Tage unseres Aufenthalts nahen, der Postmeister trocknet schon zuweilen eine Träne ab, und wir besuchen noch die Allee, um einige Gaben unsern Lieben einzukaufen. Für den, dem ich so gern etwas Angenehmes, seinem Schönheitssinn zusagendes wählte, erhandle ich eine Schlaguhr, nachdem der Jude mir bei allem was heilig, nach Judenart hundertmal geschworen, er könne sie zu dem von mir gebotenen Preis nicht lassen, und es am Ende doch tut. Schöne Tassen mit Pyrmonter Landschaften, Kristallwaren aller Art werden uns geboten, aber wir mögen uns mit so vieler Gebrechlichkeit nicht befassen. Ich wähle für Albert eine kristallne (so genannt wenigstens) Zuckerdose und eine Rahmkanne, für Fanny eine weiße Perlenschnur, für Luise einen Arbeitskorb und spare für die Kinder bis Osnabrück, um mich nicht zu sehr zu bepacken. Viele Abreisende kommen mit Tassen, Gläsern und allerhand Geräten uns entgegen, und die Trinkgelder für Brunnenschöpfer, Bademeister, Alleevogt usw. werden ausgeteilt. Am schwersten wird uns die Ausgabe für den Arzt, dem man kein Silber geben darf, und den wir gar nicht nötig hatten, da er auf seine Frage »Wie geht’s?« an jedem Morgen gottlob nichts hörte als »recht gut« und doch immer wieder kam. [...]
Der Abschiedstag ist da. Beim letzten Mittagsmahl in Pyrmont speisen wir mit unsern Hausgenossen an der Table d’Hôte und stoßen auf ewige Freundschaft, ewiges Wohl unsrer und aller unserer Lieben fleißig an. [...] Der Sachse stimmte ein Liedchen an, und fröhlich wird gesungen, bis es heißt : Wer weiß, ach wie bald zerstreut uns das Schicksal nach Ost und West. Hier scheint der Gedanke, daß wir alle uns wohl nur gekannt haben, um uns nie wieder auf der Lebensbahn zu begegnen, uns alle gleich schmerzlich zu ergreifen, und der Postmeister läßt wieder einige Tränen fallen, und fordert Champagner, die Gesellschaft zu beleben. Wir aber fürchten, sie möge zu belebt werden, empfehlen uns, um mit unserer Freundin Sophie in der Allee den Kaffee einzunehmen. [...]
Am andern Morgen, nachdem der letzte Gang zum Brunnen gemacht, allen Bekannten Lebewohl gesagt, Gläser und Stammblätter zum Andenken ausgetauscht, setzen wir uns zu Wagen, der Postmeister in die Postkutsche, die beiden Sachsen zu Pferde. Der Däne und der Assessor allein blieben zurück, und dahin ging’s unter Grüßen und Winken, solange das Auge folgen konnte, nach Ost und West.
»Auch ich war in Pyrmont«, dachte ich, noch einmal in der herrlichen Gegend umschauend, und seufzend, daß ich sie wohl nie wiedersehen werde. So wechseln die Erscheinungen auf der Bühne des Lebens wie flüchtige Schatten, und keine, wie schön und holdselig sie seien, gelingt es uns, zu erhaschen und festzuhalten. Doch wohl dem, der nur das eine Höchste, worauf sie alle hinweisend treu im Herzen bewahrend, sie ruhig kommen und verschwinden sieht, nie vergessend, daß, wenn der Vorhang gefallen, die Ausbeute vom Traum des Lebens ins wahre Leben hinübergebracht werden muß. [...]
Anmerkungen
Katharina Sibylla Busch – »Westfalens Dichterin«, wie ihre Jugendfreundin Annette von Droste-Hülshoff sie bewundernd nannte – wurde am 26. Januar 1791 als Tochter eines Landrichters in Ahlen geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Dülmen, wo Katharina Busch (als ältestes von zwölf Geschwistern) aufwuchs. Sie interessierte sich früh für Literatur und schrieb schon als junges Mädchen Gedichte. 1807 traf sie ihren – entfernt verwandten – Mentor, den früheren Göttinger Hainbündler, nunmehrigen Münsteraner Professor Mathias Sprickmann, der auch die junge Annette Droste poetisch beriet und 1813 die erste Begegnung der beiden Mädchen vermittelte. Inzwischen hatte Katharina Busch bereits mehrere Gedichte in der Literaturzeitschrift »Mimigardia« veröffentlicht. Während eines Besuchs bei ihrer Tante in Meppen hatte Katharina Busch 1810 den Juristen Modestus Schücking kennengelernt, den sie im Herbst 1813 heiratete. 1815, ein Jahr nach der Geburt des Sohnes Levin, zog man nach Sögel, wo Modestus Schücking eine Stelle als Verwaltungsbeamter des Herzogs von Arenberg erhalten hatte. Die Familie wohnte dabei im Marstall des Schlosses Clemenswerth. Seit ihrer Heirat publizierte Katharina Schücking nur noch wenig, auch wenn sie weiterhin Gedichte schrieb und sich auch an einem Briefroman versuchte, »Freuden und Leiden einer schönen Seele«, der aber nicht über das erste Stadium hinauskam. Ihre Ehe verlief zudem problematisch : zwei Kinder starben früh, und ihr Ehemann gefiel sich in allerlei aushäusigen Liebschaften. Katharina Schückings Bericht über ihre 1824 absolvierte Badereise nach Pyrmont war vermutlich als eine Art literarisches Comeback gedacht, ist aber gleichwohl zu ihren Lebzeiten nicht erschienen und kam erstmals 1936 in Druck. 1829 besuchte Katharina Schücking zum ersten Mal wieder ihr »liebes Mädchen« Annette Droste (von ihr aus irgendeinem Grund »Antonie« genannt) im Rüschhaus, die sich grad in einer massiven Lebenskrise befand und durch diesen Besuch »nach langer Jahre Trennen« (so Annette) wieder zu sich – und zurück zum Schreiben! – fand. Nur zwei Jahre darauf, am 2. November 1831, ist Katharina Schücking, eben 40jährig, nach schwerer Krankheit gestorben. »Du hast es nie geahndet, nie gewußt«, schrieb Annette Droste in ihrem bewegenden Gedicht »Katherine Schücking«, »wie groß mein Lieben ist zu dir gewesen,/ Nie hat dein klares Aug’ in meiner Brust/ Die scheu verhüllte Runenschrift gelesen, / Wenn du mir freundlich reichtest deine Hand, / Und wir zusammen durch die Grüne walten, / Nicht wußtest du, dass wie ein Götterpfand / Ich, wie ein köstlich Kleinod sie gehalten.«
Quelle
Katharina Busch-Schücking, Werke und Briefe. Herausgegeben von Jutta Desel und Walter Gödden, Bielefeld : Aisthesis, 2005, S. 15; S. 251 -273 (Auszüge).
Publikationen
| Titel | Rubrik | Verlag, Verlagsort | Erscheinungsjahr | Erwähnte Orte |
|---|---|---|---|---|
| Werke und Briefe | Hg. von Jutta Desel und Walter Gödden | Aisthesis Bielefeld | #2005 | ###morelink### |