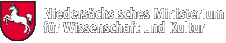Der Fünfzeiler aus Limmer und Ricklingen
Über den verkannten niedersächsischen Poeten Jakob Daniel Hahnenknoop
Er war ein komischer Dichter. Dennoch liegt eine kleine Tragik über seinem Œuvre. Er hatte bei Lebzeiten hübsche Erfolge mit seinen Versen. Dennoch blieb ihm der gebührende Nachruhm vorenthalten. Und es ist nicht einmal so, daß andere, namhaftere Kollegen an seiner Statt die Ehren eingeheimst hätten; nein, es ist im Grunde noch ärger: Was <link external-link-new-window link in neuem fenster>Jakob Daniel Hahnenknoop, der am 1. April 1898 hochbetagt Verstorbene, geschaffen hat - es wird in gegenwärtigen Literatur-Hand- büchern schlicht als Werk des »Volksmunds« ausgegeben, obendrein noch des britischen. Der »Limerick« nämlich1). Dabei ist kein anderer als eben Jakob Daniel Hahnenknoop der Schöpfer dieser Gattung von sogenannten »Nonsens«-Gedichten, die sich, relativ strikt gebaut (als Fünfzeiler mit drei bzw. zwei Hebungen, im gelind anapästischen Metrum und einem Reimschema a-a-b-b-a), um einen Ortsnamen drehen, auf einen pointierten Schlußvers zulaufen und sich bis heute, zumal bei ihren Produzenten, einer beträchtlichen Beliebtheit erfreuen.
Seit den 20er-Jahren des 19. Jahrhunderts, da sind sich die Lexikographen einig, gibt es diese »Limericks«. Was aber offenbar weder der Brockhaus noch die Encyclopaedia Britannica wissen: Das allererste Muster dieses Genres stammt von Jakob Daniel Hahnenknoop und geht so -
Es lebte ein Zwerg in Brabant,
Der grub dort im Berg, doch er fand
Weder Silber noch Gold,
Da hat er geschmollt,
Und er schrie: »Alles Gold ist nur Tand!«
Man erkennt unschwer, daß nicht allein die formalen Anforderungen der neuen Gattung erfüllt sind; auch der »Nonsens« ist unüberhörbar, hat aber gleichwohl, bei aller Zwergen- und Märchenhaftigkeit des Sujets, Methode. Unabweisbar: Hier ist ein philosophisch-anthropologisch wacher Beobachter am Dichten. Das sollte sich bis zu seinem Tod nicht ändern.
Erstaunlicherweise schrieb Hahnenknoop dies Gedicht aber durchaus noch im jugendlichen Alter: Es entstand zu der Zeit, als er Lateinschüler in Ricklingen war. Am 7. Oktober 1809 in Pattensen als Sohn des dortigen Oberfloß- und Fischmeisters Gotthilf Eberhard Hahnenknoop geboren, hatte der begabte Junge erst die örtliche Dorfschule besucht, bevor er auf das angesehene Institut in Ricklingen, dem damaligen Vorort (und heutigen Stadtteil) Hannovers, wechselte.
Ein Kuriosum am Rande: Ursprünglich sollte die ganze neue Gattung überhaupt »Ricklinger« heißen, was freilich ein wenig verwundert, da der niedersächsische Poet sein einziges unmittelbar auf diesen Schulort gemünztes Verslein erst wesentlich später ersann - im Jahr 1838 nämlich, als Hahnenknoop, mittlerweile examinierter Jurist und zugelassener königlich-hannöverscher Advokat, eine Amtmanns-Stelle im (ausländischen!) Hessisch-Oldendorf antrat. Und war's nun die leidvolle Erinnerung an die frühen Lateinstunden oder sonst ein Erlebnis von Bitterkeit2) – jedenfalls ist das Loblied auf Ricklingen ein bißchen schnöde ausgefallen:
Das niedliche Örtchen Ricklingen,
Das wollte ein Dichter besingen.
Doch dann zog er nach Hessen,
Da hat er's vergessen.
So mußte die Sache mißlingen.
Wie aber kommt es, so muß nun doch gefragt werden, daß diese genuin norddeutsche, spezifisch niedersächsische, ja: hannöversche Literaturgattung ausgerechnet im englischen Sprachraum solche Furore machte? Nun, Gewißheiten sind auf dem Gebiet des Ästhetischen wohl nie zu haben, aber wahrscheinlich war es so: Hahnenknoop begann im Jahr 1825 sein Jurastudium in Göttingen, und die hannoversche Landesuniversität war in der Epoche der hannoversch-britischen Personalunion zugleich »die« (fremdsprachliche) Hochschule für den Nachwuchs der insularen Oberschicht. Hier tummelten sich die Söhne der Earls und Dukes, selbst der Royals. Und sie tummelten sich halt nicht bloß in den Hörsälen (da tummelten sie sich sogar besonders selten), sondern auch und vor allem in den Studentenkneipen.
Aufschlußreich jedenfalls, daß Sir Andrew Marbot, der bekannte Initiator der psychologischen Kunstbetrachtung und vormalige Absolvent der Georgia Augusta, in seinen Memoiren von einem göttingischen Zechgelage berichtet, in dessen Verlauf »ein langer Bursche« (»a long fellow«)3) aus »Pottersen« unermüdlich »whimsical verses« vorgetragen habe, wie diese:
Es lebte ein Winzling in Essen,
Der liebte gewaltiges Fressen.
Er schlang wie ein Riese,
Stets Fleisch, nie Gemüse -
Das waren so seine Int'ressen. 4)
Durchaus schlüssig wäre also die Annahme, daß die offenbar begeistert aufgenommenen, neuartig witzigen Verse bei den britischen Studikern der Upper Classes auf Nachahmungsdrang stießen und so ihren Weg nach England fanden, wo es, wie wir ja wissen, bald üblich wurde, ein gut gelungenes Gedichtchen dieses Genres nach dem öffentlichen Vortrag (zum Beispiel in einem Wirtshaus) mit einem gesungenen Kehrreim zu belobigen: »Will you come up, come up, come up the way to Limerick?«
Der Literaturwissenschaft gilt dieser kehrreimende Sangesbrauch tatsächlich als Erklärung des Gattungsnamens »Limerick«. Das allerdings ist Kennern schon immer recht dünn vorgekommen. Und zu Recht. Denn tatsächlich wurden hier Ursache und Wirkung vertauscht: In Wahrheit ist das Absingen dieses Refrains nur eine Folge, weil die Gattung ja längst ihren Namen hatte - eben »Limmerick«, ein Wort freilich, das die britischen Pub-Sänger (unverständnisbedingt und darum verständlicherweise) mit der irischen Stadt Limerick in Verbindung brachten. Hahnenknoop aber hatte diesen Namen, in dem überdies der Anklang an den eigentlich geplanten »Rick«-linger erhalten blieb, »zu Ehren des Dörfchens Limmer bei Hannover«5) gewählt, wo sein Onkel Johann Joachim Tietmeyer als Rentmeister amtierte. Denn hier, in der ländlichen Idylle, pflegte Jakob während seiner Studentenzeit die sommerlichen Semesterferien zu verleben.
Sonderbar ist diese Namens-Patronage trotzdem. Denn ausgerechnet in Limmer hatte Hahnenknoop im Juli 1827 sein schmerzlichstes Liebeserlebnis zu verkraften, als ihn die dortige Pastorentochter Anna Margarethe Stöckmann erst heißmachte und dann kaltstellte. »Jacko«, wie ihn seine Kommilitonen riefen, war zu der Zeit noch nicht einmal 18 Jahre alt (Anna Margarethe war 26), und er spielte, wie's scheint ernsthaft, mit Selbstmordgedanken. Dann rettete er sich: in Lyrik. Und natürlich wählte er dazu »seine« vertraute, Sicherheit gewährende Form:
Eine eiskalte Blonde aus Limmer,
Die hatte von Lieb' keinen Schimmer.
Ein Jüngling voll Qual
Rief: »Ich spring in'n Kanal!«
Da sprach sie nur kühl: »Aber immer.«
Dieses unverkennbar autobiographisch geprägte Kunstwerk also, dessen verhaltene Selbstironie aus der Verzweiflung resultiert, ist damit der, wenn schon nicht erste (das war, wie erwähnt, der brabantinische Zwergen-Reim), so doch der buchstäbliche »Ur«-Limmerick: das älteste Exemplar dieses ortsgebundenen Genres, das den Gattungsnamen »Limmer« ausdrücklich (und, wie zu spüren: ausdrucksvoll) im Einstiegsvers führt. Daß der »Limmerick« bei den Engländern sogleich in »Limerick« umgewandelt wurde, mag sich wiederum, neben der irländischen Assoziation, auch aus der angeborenen Lässigkeit der Briten gegenüber Doppelkonsonanten erklären: Sogar »Hannover« heißt ja auf der Insel bloß »Hanover«. Für Jakob Daniel Hahnenknoop aber war das »Limmer«-Erlebnis vom Sommer 1827 folgenschwer (und vielleicht auch darum seine - gleichsam als Memento zu deutende - Wahl des Gattungs-Titels »Limmerick«): Er blieb zeitlebens Junggeselle. Ein exzentrischer Verseschmied von exzentrischer Gestalt: Unendlich groß für seine Zeit (6 Fuß, 7 ½ Zoll), dazu unendlich hager. Womöglich kam er deshalb zu dem heute, in der Aera der »political correctness«, etwas fremd anmutenden Tick, seine Werke so auffallend häufig mit kleinwüchsigen Helden auszustatten:
Es war einst ein Gnom in der Eifel,
Dem raubte sein Ohm mal das Pfeifel.
Da schlug er voll Wut
Dem Ohm auf den Hut.
Nun plagt ihn, ob's recht war, ein Zweifel.
Seinen Zeitgenossen gefiel das aber zweifellos recht gut. Jakob Daniel Hahnenknoop hat seine Opuscula, die er in abendlichen Mußestunden zu Papier brachte, immer flott an den Mann bringen können - in Zeitungen (wie der Nienburger »Harke«) oder Zeitschriften (wie dem »Leuchtturm«). Im Jahr 1870 erschien im Verlag der Hahn'schen Buchhandlung, Hannover, sogar ein richtiges Büchlein von ihm: »Limmericks aus Limmerland«. Leider ging der bescheidene kleine Band im just einsetzenden deutschen Vereinigungstaumel förmlich unter. So haben Hahnenknoops gebundene Verse, dank der Reichsgründungseuphorie, nie eine zweite Auflage erlebt und gerieten ganz zu Unrecht in Vergessenheit. Erst der nimmermüde Kurt Morawietz hat das »Limmerland«-Buch in seiner »Kleinen Geschichte der Literatur in Niedersachsen« nach Verdienst gewürdigt, obschon dem Gründer und langjährigem Herausgeber der horen eines von Hahnenknoops ganz seltenen Nicht-Limmerick-Gedichten am besten gefiel. Das wiederum läßt sich gut nachvollziehen, ist es dem Dichter darin doch gelungen, den kühnsten, wenn nicht gar den einzig möglichen Reim auf seinen Heimatort Pattensen zu finden:
Sie wollten ihn haben in Pattensen
Zum Bürgermeister - nun hattensen.6)
Interessant übrigens, daß Kurt Morawietz im Zuge seiner ausgedehnten Forschungen zum Komplex »Nibelungen« auf Jakob Daniel Hahnenknoop gestoßen war. Der einzige Limmerick nämlich, den Hahnenknoop jemals mit einem Titel versah, heißt »Die wahren Nibelungen« und geht so:
Zwei kleinere Recken aus Xanten
Zählten nicht grad zu den Militanten.
Sie waren meist hinten
Auf dem Schlachtfeld zu finden,
Wo sie vor den Feinden wegrannten.
Irgendwie wird schon nachvollziehbar, wieso Hahnenknoops programmatisch unzeitgemäße Verse im nationalen Siegesrausch nach 70/71 keine rechte Verbreitung fanden...
Um aber noch einmal auf seinen »Pattensen«-Reim zurückzukommen: Dies Stücklein war politisch gleichfalls nicht unkühn, auch wenn Hahnenknoop den Text unter dem - freilich fadenscheinigen - Pseudonym »Jakob Daniel« publizierte. Das Gedicht war im Jahr 1837 entstanden, und der darin so spitzig apostrophierte »Bürgermeister« Adam Immanuel Wiebalck war ein Günstling des soeben inthronisierten, tief reaktionären Königs Ernst August (für Hannover-Touristen: des Berittenen vom Bahnhofsplatz), der kurz darauf die »Göttinger Sieben« entließ, unter ihnen Hahnenknoops alten Lehrer Dahlmann. Doch auch für Hahnenknoop selber hatte das aufmüpfige Poem unliebsame Konsequenzen: Er verlor sein Notariat und ging ins Exil, sprich: ins liberalere Hessen.
Erst 1854 kehrte er ins Königreich Hannover zurück, wo inzwischen der blinde Monarch Georg V. regierte, und wurde Landrat in Bredenbeck am Deister. Von seinen Amtsgeschäften ließ er sich indes nicht allzusehr drücken; vor allem unternahm er jetzt ausgedehnte Reisen, am liebsten in die Alpenländer. Denn grad dort fand er immer wieder wohlklingende Anregungen für seine Limmericks. Etwa in Glurns, einer Stadt, die ihn wohl schon deshalb fasziniert haben dürfte, weil sie die kleinste von ganz Tirol ist (heute sogar von ganz Italien):
Jemand freite ein Weibchen aus Glurns,
Doch war er schon bald voll des Murr'ns.
Denn der streithaften Maid
Tat die Heirat rasch leid,
Und sie nervt' ihn mit Lauten des Knurr'ns.
Ein bisserl ein Frauenfeind ist er halt immer gern geblieben, der Hahnenknoop. Doch merkwürdig: Keine zehn Jahre nach seinem Bredenbecker Amtsantritt, gleich nach dem Tod seines verehrten (Erb-)Onkels Tietmeyer, ließ sich Hahnenknoop pensionieren und zog in dessen hinterlassenes Haus - nach Limmer! An die Stätte seiner schönsten poetischen Eingebung und seiner herbsten Reminiszenz zugleich! Die traumatische Anna Margarethe mußte er dort allerdings nicht mehr fürchten: Sie war im Jahr zuvor, unverehelicht, als Äbtissin des evangelischen Damenstifts Wienhausen gestorben.7)
So lebte Jakob Daniel Hahnenknoop denn noch mehr als drei Jahrzehnte in dem Ort, den er unsterblich gemacht hätte, wären die Zeichen der Zeit andere gewesen. Er war geachtet bei seinen Mitbürgern, die er doch um Haupteslänge überragte. Daß »seine« Schöpfung, der Limmerick, jetzt allerorten nur »Limerick« hieß - Hahnenknoop nahm es ohne Erschütterung, ja, mit heiterem Gleichmut entgegen. Daß sein poetisches Kind von anderen, zum Teil bedeutenden, Lyrikern wie Tennyson adoptiert worden war (und von weniger bedeutenden, wenngleich nicht minder berühmten wie Wordsworth adaptiert wurde) - es machte ihm keinen Verdruß, bereitete ihm eher ein stillvergnügtes Behagen. Ohnehin hatte er nichts gegen die Britonen, dafür sorgten schon seine Erinnerungen an die munteren Göttinger Kneipabende. Einmal hat er sogar einen richtiggehend anglophilen Lim(m)erick verfaßt:
Ein kleiner Franzose aus Reims
Studierte tagtäglich die Times.
Zwar verstand er kein Britisch,
Doch das sah er nicht kritisch:
Die Times war ihm Zier seines Heims.
Trotzdem: Hahnenknoop dichtete nun, immerhin bald 90jährig, nicht mehr so viel. Doch wenn er es tat, blieb er seiner alten Sache treu. Ganz spät noch, kurz vor seinem Tod, brachte der bis zum Schluß muntere Greis von einem seiner anregenden Spaziergänge durch die nähere Umgebung Limmers aus dem Nachbarort Linden einen frisch erdachten Limmerick mit, der alle Kennzeichen seiner früheren Verse trägt (freilich auch, wie wir hinzusetzen müssen, seiner früheren Marotten...):
Ein niedrig Gewachs'ner aus Linden
War bei Andrang schwer wiederzufinden.
Man gab ihm 'ne Leiter,
Drauf stelzt er wie 'n Reiter,
Und auf einmal war Schluß mit Verschwinden. 8)
Nun gut, von seinem Dauerthema (das er während seiner Exilzeit, den hannoverschen Ernst August im Blick, auf die Formel gebracht hatte: »Dieses ist die Zeit der Kleinen«) mochte er einfach nicht lassen. Seltsam jedoch, wie diese letzten lyrischen Worte des verschollenen Dichters den nachgeborenen Leser berühren: Und auf einmal war Schluß mit Verschwinden! Steckt nicht, insgeheim, eine gewisse Prophetie in diesen Worten? Denn ist es nicht eben dies, was wir dem Poeten Jakob Daniel Hahnenknoop, dem Schöpfer des Limmerick, hundert Jahre nach seinem irdischen Tod am meisten wünschen möchten? Schluß mit Verschwinden! Genau.
Anmerkungen
1) Gero von Wilpert spricht in seinem »Sachwörterbuch der Literatur« sogar davon, daß der »Ursprung« des Limerick »ungeklärt« sei und die »dt.« Limericks Nachahmungen der englischen Originalform wären. Heavens!
2) Die Akten der ehem. Lateinschule Ricklingen weisen aus, daß der Schüler J.D.H. am 17. 2. 1824 mit einer Karzerstrafe belegt wurde, weil er zur Unterrichtszeit und zigarrerauchend im hannoverschen »Café Robby« (heute: Mövenpick) angetroffen wurde.
3) Mrs. Drabble, die Verfasserin des »Oxford Companion of Literature« (5. Aufl.) wollte in dieser Formulierung (»a long fellow«) eine Anspielung auf den amerikanischen Lyriker H. W. Longfellow erblicken, den sie daraufhin als den eigentlichen Erfinder des »Limerick« ausmacht, zumal sich Longfellow im fraglichen Zeitraum tatsächlich in Deutschland aufgehalten hat. Nachforschungen in jüngerer Zeit ergaben indes, daß der Dichter der »Hiawatha« zwar studienhalber in Göttingen gewesen war, doch mit Sicherheit nicht aus »Pottersen« stammte. So wenig wie aus »Pattensen«, das Sir Andrew Marbot offenkundig gemeint hatte. (Vergl. dazu auch: Thomas O'Kiep, Limerick, Limmerick and a long fellow. In: Irish Items, Dublin 3/97, S. 17 - 84)
4) Sir Andrew gibt diese Verse in seinen Memoiren im deutschen Original wieder. Die fehlenden Tüttelchen über dem »Gemuse« wurden stillschweigend hinzugefügt.
5) Das Zitat stammt aus einem Brief, den J.D.H. am 3. April 1858 an seinen Freund, den Heustedter Obergerichtsanwalt Bruno Baumann schrieb und in dem er sich vornehmlich für Baumanns Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag bedankt. Der Brief ist somit nicht nur ein Beleg für die Gattungs-Benennung »Limmerick«, sondern darüber hinaus ein Dokument der liebenswürdigen Sensibilität des Dichters: Der hyperaktive Bruno Baumann hatte übersehen, daß Hahnenknoop zu dieser Zeit erst auf 49 Lebensjahre zurückblickte. Der Adressat geht mit keinem Wort auf diesen Lapsus ein.
6) In ihrer Studie »War Goethe Schillers Flöte? 100 Fragen zu Leben undWerk des Dichters« haben Ronald Meyer-Arlt und Heiko Postma 1999 den Nachweis geführt, daß der Dichterfürst den Limmerick-Dichter einmal in Pattensen besucht hat. Nach Ausweis dieser Forschungsarbeit habe Goethe den wortkargen Kollegen sehr geschätzt (»es ist bei ihm alles prägnant«) und näher an sich binden wollen: »Wählen Sie Weimar zu Ihrem Wohnort!« Hahnenknoop sei aber lieber daheim geblieben, und so habe Johann Peter Eckermann aus Winsen/Luhe die Adlatus-Stelle bekommen.
7) Ganz wohl war ihr aber offenbar nie gewesen, wenn sie daran dachte, wie kalt sie den liebestollen Jüngling damals abgefieselt hatte. In ihrem Nachlaß fand sich ein Oktavheft mit einem selbstverfaßten Prosastück, betitelt »Limmerick und die Grethe«, das von den Erben für eine - leicht hirnrissige - irische Reise- und Liebesphantasie gehalten wurde. Wir jedoch wissen es besser.
8) Der Text stammt aus dem handschriftlichen Nachlaß des Dichters. Die Einsichtnahme in das Konvolut, das noch eine Reihe weiterer ungehobener Schätze birgt, verdanke ich Herrn Dr. Karl Krummhardt, dem Ortsarchivar von Limmer, der seit einiger Zeit dabei ist, im dortigen Volkskunde-Museum eine Hahnenknoop-Stube einzurichten.
Hinweis: Ein Reprint des 1870 erschienenen Buches von Jakob Daniel Hahnenknoop »Limmericks aus Limmerland«, dem (mit Ausnahme des Linden-Limmericks und des Pattensen-Verses) alle zitierten Gedichte entnommen sind, wird in absehbarer Zeit im Trellis Verlag, Limmer/Ricklingen, herauskommen.
Thomas O'Kiep, geb. 1946 in Balleyjosullivan/Connemara, Rep. of Ireland; wegen der irischen Kartoffelkrise 1957 nach Deutschland verschickt; Schulzeit und Abitur in Bremerhaven; Studium (Dt. Literatur u. Irische Politik) in Hannover u. Dublin. Publikationen: Biographien (Robert Burns, Thomas Moore, H.A. Oppermann), Essays, Übersetzungen aus dem Gälischen und Schottischen. Lebt als freier Autor abwechselnd in Lyme und Linden.